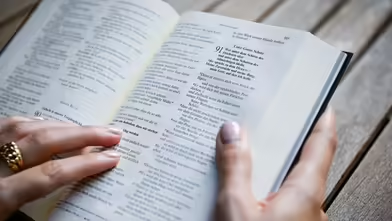Als der damalige Präfekt der Glaubenskongregation, Kardinal Josef Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., und der Sekretär der Kongregation, Tarcisio Kardinal Bertone, die Erklärung "Dominus Iesus" veröffentlichten, fühlten sich die Evangelischen nicht nur in Deutschland vor den Kopf gestoßen.
Denn das päpstliche Dokument unterschied zwischen der katholischen Kirche, gültigen Teilkirchen und "kirchlichen Gemeinschaften" - wer den gültigen Episkopat und die eucharistische Gemeinschaft mit Rom nicht bewahrt hat, wurde vom Vatikan nicht als Kirche anerkannt.
Deutliche Worte von Landesbischof Huber
Der damalige Berliner Landesbischof Wolfgang Huber nahm bei einem Symposion in der Berliner Humboldt-Universität kein Blatt vor den Mund. "Ökumene bedeutet jedoch nicht eine Verständigung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner; und sie bedeutet auch nicht die Rückkehr der getrennten Halbgeschwister in den Schoß einer allein seligmachenden Kirche", sagte er am 14. September 2000. "In dieser Hinsicht hat die Erklärung "Dominus Iesus" für Klarheit gesorgt: Sie hat am römisch-katholischen Kirchenverständnis genau diejenigen Züge scharf hervortreten lassen, die es für evangelische Christen dauerhaft unannehmbar machen."

Damit sei zugleich klargestellt, dass Ökumene auf Dauer das gemeinsame Zeugnis der Verschiedenen, nicht etwa die Herstellung einer organisatorischen Einheit bedeute. "Die ökumenische Zukunft der Kirchen hat damit zu tun, dass die verschiedenen christlichen Kirchen die Vielfalt ihrer Profile und Traditionen in das gemeinsame Zeugnis und den gemeinsamen Dienst an der Gesellschaft einbringen", sagte Huber.
"Doch diese Vielfalt kann ökumenisch nur fruchtbar werden, wenn die Kirchen ihren Beitrag in der Gesellschaft auf der Grundlage der Gleichachtung und Gleichberechtigung erbringen." Und sie dürfe nicht verdunkeln, dass das "was die Kirchen verbindet, bedeutsamer ist als das, was sie trennt: das Bekenntnis zur Annahme jeder menschlichen Person in Jesus Christus und deshalb das Eintreten für die gleiche Würde jeder menschlichen Person." Das Konzept der Ökumene der Profile war geboren.
Wie blickt die EKD heute darauf?
Und heute? Einer der profiliertesten Theologen der EKD, der Leiter der Abteilung kirchliche Handlungsfelder im Kirchenamt der EKD, Johannes Wischmeyer, sieht den vatikanischen Text mittlerweile differenzierter. "Die Erklärung schreibt den institutionellen Vorrang und die alleinige Vollgültigkeit der römisch-katholischen Kirche in einer äußerst selbstbewussten Weise fest, sie bezeichnet - zumindest fallweise - nichtchristliche religiöse Praktiken als Aberglaube und Irrtum, zumindest als schwer defizitär", sagt Wischmeyer. "Dies empfanden manche Nichtkatholiken als verletzend."
Es entbehre dabei nicht der Wahrheit, dass evangelische Kirchen ein vom römisch-katholischen deutlich abweichendes Kirchen- und Amtsverständnis hätten. "Der von vielen seinerzeitigen Akteurinnen und Akteuren als übergriffig empfundene Hinweis auf das Trennende zwischen den christlichen Konfessionen lässt sich im Rückblick - freundlich gelesen - auch als eine Mahnung zum Realismus verstehen", sagte Wischmeyer.

"Obgleich seither erfreulicherweise auf manchen Feldern praktisch gelebten Christentums Fortschritte im evangelisch-katholischen Miteinander erzielt wurden, gab es im ökumenisch-theologischen Dialog bei der Diskussion der in "Dominus Iesus" brüsk ins Scheinwerferlicht gerückten unterschiedlichen Glaubensüberzeugungen im letzten Vierteljahrhundert wenig greifbare Fortschritte."
Wischmeyer erinnert daran, dass Ratzinger die Formulierungen von "Dominis Iesus" etwas korrigiert habe: Evangelische Kirchen seien "auf andere Weise Kirche" und wollten dies ja auch sein. Zudem werde oft die theologische Qualität der Erklärung übersehen, die "ihrem Selbstverständnis nach nicht rückschrittlich argumentiert, sondern die im II. Vaticanum festgeschriebenen Erkenntnisse lehramtlich festklopfen möchte und dabei auch einer Reihe weiterer, seinerzeit aktueller katholischer Positionsbestimmungen aufnimmt."
Der interreligiöse Dialog werde etwa mit einer gelungenen Formulierung nicht nur als zum Evangelisierungsauftrag der Kirche gehörig qualifiziert. Er führe vielmehr "zu einer Haltung des Verständnisses und zu einer Beziehung der gegenseitigen Kenntnis und der wechselseitigen Bereicherung, und zwar im Gehorsam gegenüber der Wahrheit und mit Respekt vor der Freiheit".
Einige Prinzipien nicht teilbar
Doch auch Wischmeyer betont: "Selbstverständlich werden evangelischen Kirche und Theologie eine Reihe der in "Dominus Iesus" festgeschriebenen Prinzipien nicht teilen können", so der Theologe.
"Das betrifft in inhaltlicher Hinsicht die Vorstellung einer universalen Heilsmittlerschaft der Kirche, vor allem aber die Subsistenz der einen Kirche Christi in der (römisch-)katholischen Kirche; auch das sehr enge Zusammenrücken von sichtbarer, institutioneller Kirche und Reich Gottes."

Protestantische Theologie habe nach der Aufklärung "subjektphilosophische Ansätze überwiegend positiv integrieren können". Man werde die Kirche "nicht in derselben Weise wie 'Dominus Iesus' von einer Diktatur des Relativismus bedroht" sehen. Auch der wahrnehmbare geschichtstheologische Duktus sei der aktuellen deutschsprachigen evangelischen Theologie fremd. "Was den universalen Heilsanspruch der biblisch grundierten christlichen Offenbarung und die unrelativierbare soteriologische Bedeutung der Person Jesu Christi betrifft, erinnert die Erklärung, in markantem Duktus, an unverlierbare ökumenische Grundwahrheiten", so Wischmeyer.
Es bleibe aber die Hoffnung, dass "eine genauere Sicht auf die Grundlagen der jeweiligen Bekenntnistradition - etwa auch auf die Dokumente des II. Vaticanum -, vor allem aber gemeinsame exegetische Arbeit, für die ja der Theologe Joseph Ratzinger beispielhaft stand, mit der Zeit ein Mehr an gemeinsamer Erkenntnis zutage fördern wird."