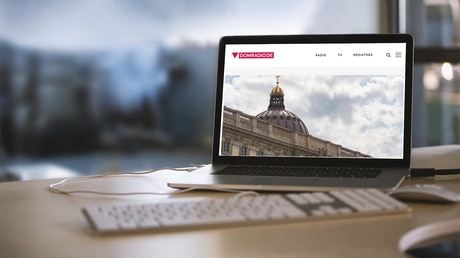Feuerwehrleute aus Frankfurt halfen bei der Ausbildung von Kollegen in Granada, Nicaragua. Bürger in Aachen sammelten Fahrräder für die Armensiedlung Kayelitsha bei Kapstadt. Und Münchner Wasserexperten suchten nach Lecks im maroden Kanalsystem in Simbabwes Hauptstadt Harare. Es geht meist um praktisches Zupacken, wenn eine Stadt in Deutschland sich mit einer Stadt in einem Entwicklungsland zusammentut. Etwa jede dritte Kommune in Deutschland, so schätzen Wissenschaftler, engagiert sich in der Zusammenarbeit mit Afrika, Asien und Lateinamerika.
Der nordrhein-westfälische Integrationsminister Armin Laschet (CDU), Hauptveranstalter der Konferenz, machte sofort klar, dass die Kommunen und Länder nicht in Konkurrenz zur Entwicklungspolitik des Bundes treten wollten und könnten.
Das bekräftigte auch der Aachener Oberbürgermeister Jürgen Linden (SPD) am Beispiel der Verbindung zu Kayelitsha in Südafrika: «Diese Partnerschaft wird getragen von den Bürgern.» Aber es sind wenige. Nur ein bis zwei Prozent der 260.000 Aachener engagierten sich und nur 10 bis 15 Prozent interessierten sich dafür, sagte Linden. Der OB setzt auf die junge Generation. Nun kooperieren auch Schulen miteinander, planen gemeinsame Projekte. «Das Allerwichtigste ist, sich zu treffen, sich kennenzulernen.»
Von Freundschaften zwischen Menschen auf verschiedenen Kontinenten erhofft sich auch Bundespräsident Horst Köhler viel. Er wirbt insbesondere für Partnerschaften zwischen Hochschulen. Und: «Projekte aus der Mitte der Bürgergesellschaft machen Entwicklungspolitik konkret erfahrbar.» Bundesentwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD) räumt ein, dass die Kommunen den Bürgern den Eine-Welt-Gedanken nahebringen, Wissen über Armut und deren Hintergründe vermitteln. Umso größer die Chance, dass sich Steuerzahler vom Sinn staatlicher Entwicklungshilfe überzeugen lassen.
Nüchtern gab sich Helen Zille, die neue Ministerpräsidentin der Westkap-Provinz in Südafrika, der einzigen Provinz im Land, die von der Opposition regiert wird. Wenn Schulhöfe verschönert oder Musikinstrumente angeschafft würden, gut und schön. Aber im schlimmsten Fall lenke das davon ab, die dringendsten Probleme des Bildungswesens zu lösen. Zilles Diagnose: Dramatisch hohe Fehlzeiten bei Schülern, geringes Verantwortungsgefühl bei Lehrern - und Schulbücher, die sich nicht zum Selberlernen eignen.
Große Summen kann eine deutsche Stadt kaum für Afrika locker machen. Sie ist in der Regel auf Spender und Sponsoren angewiesen. Bernd Schleich winkt ab: «Es geht nicht um Geldtransfer.» Gefragt seien ganz praktische Kenntnisse, etwa zur Sicherheit in Fußballstadien, erklärte der Geschäftsführer der Gesellschaft Inwent (Internationale Weiterbildung und Entwicklung), die Vertreter von Kommunen im Nord-Süd-Dialog berät und trainiert.
Bei den kommunalen Partnerschaften mit Afrika stehe ohnehin das entwicklungspolitische Lernen in Deutschland absolut im Vordergrund: «Unsere Bürger sind die Nutznießer.» Die Folge ist, dass einzelne Städte und Gemeinden zum Vorreiter werden. Sie beschlossen Regeln für die Förderung von Wind- und Wasserkraft oder für den Ausschluss von Kinderarbeit, lange bevor sich Bundesländer oder Bundestag damit befassten.
Konferenz diskutierte über Partnerschaften zwischen deutschen und afrikanischen Städten
Fahrräder für Kayelithsa
Mit den Chancen und Grenzen der Projekt- oder Städtepartnerschaften zwischen Nord und Süd befassten sich rund 700 Teilnehmer der 2. Bonner Konferenz für Entwicklungspolitik, die am Freitag zu Ende ging. Schafft die Kooperation von Stadt zu Stadt, von Bundesland zur Provinz, bereits eine neue Architektur der Entwicklungshilfe?

Share on