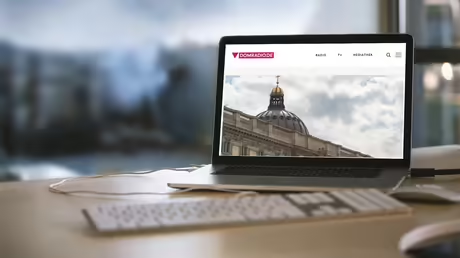Er gilt als eine der kritischsten Stimmen in der Krise: Fukushimas Gouverneur Yuhei Sato. Mehrfach hat er deutlich gemacht, dass er sich endlich Klarheit von Regierung und Atomkraftlobby wünscht. Ein Treffen mit Tepco, der Betreiberin des havarierten AKW Fukushima Daiichi, schlug Sato unlängst aus. "Am wichtigsten ist, dass Tepco höchste Anstrengungen unternimmt, um diese Krise zu beenden", betonte der Gouverneur im japanischen Fernsehsender NHK.
Tepco hat sich mittlerweile bei der Bevölkerung rund um das AKW entschuldigt. "Gemessen an der Sorge, dem Ärger und Frust der Menschen in Fukushima gibt es für mich keinen Anlass, diese Entschuldigung zu akzeptieren", sagte Sato.
Im schwer beschädigten AKW Fukushima droht die Lage immer wieder außer Kontrolle zu geraten. Die radioaktive Strahlung einzudämmen ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Ein paar hundert Männer riskieren Leib und Leben, um noch mehr Schaden von den eigenen Landsleuten abzuwenden. Mindestens zwei Arbeiter wurden bislang wegen massiver Verstrahlung in eine Spezialeinrichtung eingeliefert.
Die Krise in Japan sucht ihresgleichen: Nicht nur, weil sich Meldungen über radioaktiv verseuchte Lebensmittel und Strahlungen im Meerwasser häufen. Auch fühlten sich viele Menschen in den vergangenen zwei Wochen von Tokios Politikern im Stich gelassen. "Die Regierung sagt uns doch nicht, was wirklich passiert ist", monierte ein Bewohner aus Fukushima-Stadt. Er habe mehr Angst vor der Strahlung als vor einem Tsunami. Ein Mann, der aus der Stadt Iwaki in der Präfektur Fukushima in den Großraum Tokio evakuiert wurde, kritisierte im japanischen Fernsehen, Tepco hätte für diesen Fall besser vorbereitet sein müssen.
Bohrende Fragen
Mit der ungewöhnlich deutlichen Kritik gingen weitere bohrende Fragen einher: Warum ist die Hilfe so schwer angelaufen? Und warum starben Dutzende, vor allem alte Menschen, die das Beben und den Tsunami überlebt hatten, in der Zwischenzeit? "Alle, mit denen ich gesprochen habe, sagen, dass ihnen nichts geblieben ist und sie bei Null wieder anfangen müssen", umschreibt ein Mann in der schwer getroffenen Präfektur Miyagi sein Leben. "Wie viel wir schaffen können, wissen wir nicht." Die Zahl der Toten und Vermissten ist derzeit auf weit über 27.000 angestiegen.
Trotz allem bleiben die an Katastrophen gewöhnten Japaner diszipliniert, brechen nicht in Panik aus. Das, was die Gesellschaft des Inselstaates ausmacht, die Auffassung von Pflicht, Ehre und Dienst an der Gemeinschaft, zahlt sich in der Krise aus: Es gibt keine Gewalt und keine Plünderungen. Etliche Hilfsinitiativen organisierten Lieferungen von Lebensmitteln, Sanitärartikeln und Decken in den zerstörten Nordosten. Dort leben immer noch etwa 250.000 Menschen in Notunterkünften.
Ausgeprägter Gemeinschaftsgeist
"Dieser Gemeinschaftsgeist ist in Japan sehr ausgeprägt", schreibt auch Schwester Caelina Mauer in ihrem Kurz-Blog. Die deutsche Nonne, die dem Orden der Thuiner Franziskanerinnen angehört, leitet ein Kinderheim in Ichinoseki in der Präfektur Iwate, das durch die Katastrophe stark beschädigt wurde. Man habe vom Stadtkrankenhaus reichlich Reis bekommen, weitere Spender hätten für Gemüse, Obst und Schokolade gesorgt, erzählt die Ordensschwester. Gleichzeitig habe die Vereinigung der Kinderheime in der Präfektur beschlossen, jeweils einen freiwilligen Helfer kurzzeitig dorthin zu schicken, wo die Not ebenfalls groß ist, zum Beispiel nach Ofunato an der Pazifikküste.
Schwester Caelinas eigenes Kinderheim ist nur etwa 150 Kilometer Luftlinie von Fukushima entfernt. Aber viele hier seien durch die Naturkatastrophe so traumatisiert, schrieb sie erst kürzlich, dass es schwer falle, sich auch noch mit der drohenden Atomgefahr auseinander zu setzen. Währenddessen ist Gouverneur Yuhei Sato immer noch der erste Vertreter der politischen Klasse, der von einer "nuklearen Katastrophe" spricht und dringend um Unterstützung bittet.
Ungewöhnlich laute Kritik in Japan zwei Wochen nach Erdbeben
Frust und offene Worte
Zwei Wochen ist es her, dass die schlimmste Naturkatastrophe seit Menschengedenken Japan heimgesucht hat. Dem Erdbeben der Stärke 9,0 folgte ein Tsunami, hinzu kommt die atomare Bedrohung. Trotz allem bleiben die Japaner diszipliniert – doch Kritik wird immer lauter.

Share on