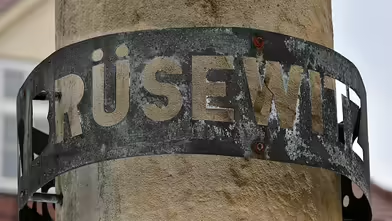DOMRADIO.DE: Frau Lahl, zwei Monate, bevor am 9. November 1989 die Mauer fiel, sind Sie mit Ihrer Familie aus einem Bulgarien-Urlaub nicht mehr nach Hause in die DDR zurückgekehrt, sondern über Ungarn in den Westen geflohen. Wenige Wochen später brach das ohnehin schon angeschlagene und von der Sowjetunion nicht mehr unterstützte SED-Regime zusammen. Seitdem sprechen Sie für sich von einem zweiten Leben. Wie schauen Sie auf die letzten 34 Jahre zurück?

Kristina Lahl (Gebürtige Chemnitzerin, Juristin und heute Kommunikationstrainerin): Jetzt, mit fast 65 Jahren u nd Kindern, die längst aus dem Haus sind, komme ich allmählich zur Ruhe und beginne zu reflektieren und zu begreifen, was da in meinem Leben eigentlich passiert ist. Erst in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, dass ich voll meine Fähigkeiten entwickeln, meine Kraft und auch Lebensfreude spüren und – ganz wichtig – mir selbst vertrauen kann. Ich bin zwar getauft, aber nicht kirchlich aufgewachsen und habe dennoch immer erlebt, dass ich gehalten werde – egal, wie es auch in meinem Leben gekommen ist.
30 Jahre habe ich in Ostdeutschland gelebt, überwiegend in Chemnitz, vier Jahre war ich zum Jura-Studium in Halle. Diese Zeit in der DDR hat mich sehr geprägt, und die schüttelt man auch nicht einfach so ab. Manche Weichen haben damals andere für mich gestellt, gegen meinen Willen. So habe ich zum Beispiel das Studium der Staats- und Rechtswissenschaften nur absolviert, weil ich mir meinen beruflichen Traum nicht erfüllen durfte.

DOMRADIO.DE: Was wäre das denn gewesen?
Lahl: Zum Fernsehballett nach Berlin in den Friedrichsstadtpalast zu gehen und dafür die Ballettschule in Dresden zu besuchen. Allerdings fanden meine Eltern den Beruf der Tänzerin nicht zukunftsfähig. Nach dem Abitur wollte ich Lehrerin werden – das war nicht möglich, weil ich mit 14 Jahren durch die logopädische Prüfung gefallen bin und damit keinen Studienplatz für Pädagogik erhalten habe. Das war reine Willkür, und diese Absage erscheint rückblickend besonders absurd, da ich heute in meinem Beruf ausgerechnet mit meiner Stimme viel arbeite.
Für Jura gab es damals viele Bewerber. Da habe ich gedacht, die nehmen dich ja sowieso nicht – was mir ganz recht gewesen wäre, da es nicht das war, was ich eigentlich studieren wollte. Wider Erwarten aber wurde ich zum Jurastudium zugelassen, das ich dann mit dem Schwerpunkt Wirtschaft absolviert habe. In der DDR hat man ja auch fertig studiert. Hätte ich abgebrochen, wäre kein anderes Studium mehr für mich möglich gewesen. Was ich aber wirklich wollte, hat sich für mich als junge Frau nicht erfüllt.
In meinem Beruf als Wirtschaftsjuristin habe ich bis Sommer 1989, bis zu unserer Flucht, gearbeitet. Immer mehr machte mir allerdings zu schaffen, dass ich auch Unrecht zu vertreten hatte, wenn politische Entscheidungen das verlangten. So ging es um unrechtmäßige Enteignungen von Privatgrundstücken, wenn der Staat diese Grundstücke brauchte, oder um Rechtsberatung, die Ausreisewilligen nicht zuteil wurde. Ja, ich wurde als Staatsfeind bezeichnet, weil ich den Menschen Glauben schenkte, die ihren Ausreiseantrag gestellt hatten und nun vom Staat Repressalien erfuhren – teils, indem sie ihre Arbeit verloren, oder sie vollständig vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen wurden. Das habe ich kaum ertragen.
DOMRADIO.DE: Was fühlen Sie heute, wenn Sie auf diese Zeit und dann später Ihr Leben in Westdeutschland zurückblicken?
Lahl: Als würde ich zwischen zwei Welten leben. In Westdeutschland bin ich immer "die aus dem Osten". Aber dorthin gehöre ich nicht mehr, selbst wenn ich da groß geworden bin. Schließlich habe ich die weitere Entwicklung des Ostens nach der Wiedervereinigung nicht mehr aktiv mitbekommen.

Ich weiß nur, dass ich die Wende damals als Übernahme erlebt habe. Natürlich war die DDR ein Unrechtssystem, das bis hin in die privatesten – auch partnerschaftlichen – Beziehungen massiv eingegriffen und manipuliert hat. Auch das habe ich selbst persönlich erlebt. Als meine zweieinhalb Jahre alte Tochter lebensgefährlich erkrankte, das aber zunächst kein Notarzt erkannte, wurde sie schließlich zweimal notoperiert. Ich durfte sie aber erst nach drei Wochen zum ersten Mal wieder sehen. Regelrecht ferngehalten hat man mich im Krankenhaus von ihr. Das war für meine Tochter, aber auch für mich eine große traumatische Erfahrung.
Als ich mich dagegen gewehrt habe, dass sie auch noch allein zu einer Kur geschickt werden sollte, und mich wegen der schlechten Versorgung beschwerte, bekam ich einen ausführlichen Vermerk in meiner Stasi-Akte und wurde von da an zuhause und an meinem Arbeitsplatz beobachtet. Die Einträge zu dieser "Begutachtung", die ich später gelesen habe, sind einfach menschenverachtend. Heute weiß ich aus den Aufzeichnungen, dass meine panische Angst, die nehmen dir dein Kind weg, begründet und der Grat damals äußerst schmal war.
Und trotz allem, was ich an Willkür und Unmenschlichkeit erlebt habe, muss es legitim sein zu sagen: Ja, ich bin geflüchtet, ich wollte weg aus diesen Verhältnissen der Kontrolle, Repressalien und Unfreiheit und – gleichzeitig – ich vermisse meine ursprüngliche Heimat. Es gab auch sehr viel Schönes in meiner Kindheit und Jugend. Daher sollten wir uns vor einer Schwarz-Weiß-Malerei hüten! Das Ganze ist sehr viel komplexer, und es braucht einen differenzierten Blick auf das Leben in der ehemaligen DDR und auf die Menschen dort, die in diesem System gelebt haben.

Noch ein Beispiel: Weil ich früher mein Kind in die Krippe gegeben habe, um arbeiten zu können, galt ich im Westen als Rabenmutter. Wenn ich heute sehe, dass Mütter ihre Babys früh morgens in die Kitas bringen, damit sie ihren Beruf ausüben können, ist das doch das Gleiche, oder? Also, man sollte schon ganz genau hinsehen und nichts bewerten, was man nicht selbst erlebt hat.
DOMRADIO.DE: Was hat sich für Sie 1989 maßgeblich geändert?
Lahl: Ich bin seitdem frei in meiner Meinungsäußerung. Beruflich musste ich allerdings nochmals völlig neu starten. Mein Studium und die neun Jahre meiner Arbeit als Justitiarin wurden nur teilweise anerkannt, und ein erneutes Studium war mir aufgrund meiner familiären Situation mit zwei kleinen Kindern nicht möglich.
Heute stehe ich auf eigenen Beinen, habe diverse Fortbildungen absolviert und Zusatzqualifikationen erworben, ein Unternehmen aufgebaut und biete Seminare, Beratung und Coachings an. Ich kann meine Neigungen leben und bin unabhängig. Was mir in frühen Jahren verwehrt wurde, habe ich mir zurückgeholt. In diesen letzten 34 Jahren habe ich mehr und mehr meine Stärken gelebt und konnte mein eigentliches Ich zur Entfaltung bringen.
DOMRADIO.DE: Mit der Unterzeichnung des Einheitsvertrages am 30. August 1990 wurde das Wort vom Zusammenwachsen Deutschlands zur Vision und gleichzeitig zum Auftrag für zwei völlig unterschiedliche Politik- und Gesellschaftssysteme. Wie sehen Sie heute das Ost-West-Verhältnis?
Lahl: Auf der persönlichen Ebene erlebe ich viel Verständnis und sehe dieses Zusammenwachsen als geglückt an. Im Laufe der Jahre haben sich tolle und beständige Freundschaften entwickelt, und auch im Beruf erfahre ich Anerkennung und Bestätigung.
Aber im gesamtgesellschaftlichen Kontext sind wir noch lange nicht zusammengewachsen. Da wird immer noch das Narrativ bedient: Sachsen steht für den ganzen Osten, wo man unselbstständig ist, alle bei der Stasi waren, wo gedopt wurde, heute alle Nazis sind und so komisch gesprochen wird. So jedenfalls ist größtenteils die westdeutsche Wahrnehmung.
Dabei ist nicht der Osten das Problem. Problematisch sind die auf ihn bezogenen primitiven, fast immer negativ verwendeten Attribute. Noch immer wird bei der Herkunftsbezeichnung klar zwischen Ost und West unterschieden. Dazu gehört vor allem auch die Frage "Wo kommst Du denn eigentlich her?", um im gleichen Atemzug hinterher zu schieben "Doch bestimmt aus dem Osten". Und das selbst 2023 noch!
Wird damit eine Schublade aufgemacht, um eigene Vorurteile bestätigt zu bekommen? Denn die Frage suggeriert doch eigentlich, dass man hier nicht wirklich hergehört. Diese gesellschaftliche Stigmatisierung ist so ermüdend, dass ich es manchmal leid bin, meine eigene Geschichte immer wieder zu erzählen. Natürlich könnte ich meinen Dialekt ablegen, denn schon allein deswegen werde ich hier in Westdeutschland ja immer wieder nach meiner Herkunft gefragt. Aber das will ich nicht. Kein Bayer, kein Rheinländer, kein Hamburger und kein Schwabe hat ein Problem damit, seine Herkunft öffentlich zu benennen, nur Menschen aus dem Osten.
Die Frage nach der Herkunft macht einen oft sofort klein. Tatsache ist, dass viele nach der Wende ihre Arbeit verloren haben, aus ihren Berufen raus mussten, weil es diese Arbeit plötzlich nicht mehr gab, ihre Kompetenz nicht mehr gefragt war. Auch das gehört zu meinen persönlichen Erfahrungen im Westen. Die DDR war ein Fall für Entwicklungshilfe geworden – nach dem Selbstverständnis des Westens. Und sogar nach über 30 Jahren definiert sich der Westen immer noch als Norm, während er den Osten als Abweichung davon sieht. Vieles wird immer noch von einer westdeutschen Perspektive dominiert. Lange wurden Vorurteile geschürt wie: Die im Osten sind noch nicht soweit. Die sind so durch die Diktatur geprägt, denen müssen wir erst einmal das Denken beibringen. Aus Ostdeutschland übernommen wurde eigentlich nur das grüne Ampelmännchen.
DOMRADIO.DE: Haben Sie sich aus dieser Denkspirale lösen können?
Lahl: Lange Zeit nicht, inzwischen immer mehr. Tatsache war, man gehörte in der DDR nie der freien Klasse an, das machte einen im Westen schnell zu einem Menschen zweiter Klasse. Wegen der begrenzten Kita-Zeiten meines Sohnes und damit der begrenzten Möglichkeiten, selbst arbeiten zu können, habe ich 1994 stundenweise in einem Callcenter angefangen und bin dann nach und nach bis zur Teamleiterin und Trainerin aufgestiegen – eben weil ich mich über Leistung definiert habe. Das kannte ich gut aus meiner Zeit in der DDR: Gute Leistungen brachten Anerkennung.
DOMRADIO.DE: In der Tat, so kennt man das, nicht zuletzt ja vom Leistungssport in der DDR…
Lahl: Eigentlich war mein Leben immer anstrengend, sonst wäre ich aber auch in diesem System untergegangen. Wie oft habe ich mich trotz meiner Stärke machtlos gefühlt! Ich war nie in der SED. Deshalb wurde mir aber auch mancher berufliche Weg verwehrt. Trotzdem habe ich es zur stellvertretenden Kombinat-Justiziarin geschafft. Unter Druck, der Partei beizutreten, wurde ich dennoch permanent gesetzt. Heute würde man das als Mobbing bezeichnen.

DOMRADIO.DE: Sie haben die eine Hälfte Ihres Lebens in der ehemaligen DDR verbracht, die andere in Süddeutschland, weil Sie dort die Landschaft der Schwäbischen Alb an das Erzgebirge erinnerte. Lassen sich beide Teile überhaupt in eine Biografie integrieren? Und wie erleben Sie sich selbst in diesem Spannungsfeld?
Lahl: Das ist für mich kein Spannungsfeld, vielmehr empfinde ich mittlerweile eine Heimatsehnsucht nach meinem Ursprungsland, das es nicht mehr gibt. Früher konnte ich mir solche Gefühle nicht erlauben, da ging es immer nur um den nächsten Schritt. Aber heute denke ich viel zurück. Ich habe nun mal beide Anteile in mir: ostdeutsche Wurzeln und dann mein zweites Leben in Westdeutschland. Manches zieht sich auch wie ein roter Faden durch meine Biografie. So habe ich mich immer schon ehrenamtlich engagiert, in der DDR nannte sich das "der Solidaritätsgedanke". Etwas für andere zu tun war demnach immer schon in meinen Werten angelegt. Von daher wehre ich mich einfach gegen Pauschalurteile wie "Die DDR war per se schlecht" und "die BRD ist per se gut", auch wenn sich solche unreflektierten Aussagen durch meine gesamte Biografie ziehen und bis heute auch durch die meiner Kinder.
DOMRADIO.DE: Auch Begriffe wie "Mauer in den Köpfen" oder "Besser-Wessis" halten sich hartnäckig – selbst noch nach mehr als drei Jahrzehnten Mauerfall. Haben wir noch einen langen Weg vor uns?

Lahl: Das Wort von der "Mauer in den Köpfen" mag ich gar nicht; es hört sich so nach "fest zementiert" an. Ich sehe da eher einen großen Schrank mit vielen Schubladen, die immer dringender entstaubt und aufgeräumt werden müssten.
In Westdeutschland gelte ich als jemand, der es "geschafft" hat. Allein darin liegt schon eine Wertung, die bei vielen noch genauso drin ist. "Sie hat’s geschafft, obwohl sie aus dem Osten kommt." Ja, wir sind in einem anderen Staatssystem aufgewachsen, aber wir können trotzdem selbständig denken, Verantwortung übernehmen und erfolgreich sein.
Gesamtgesellschaftlich wird selbst heute noch mit bestimmten Zuschreibungen Schubladendenken bedient. Ostdeutsche, die gegen alle Widerstände und alle Wahrscheinlichkeit erfolgreich geworden sind und sich etabliert haben, räumen ein, ihre Herkunft verschwiegen oder nur im Notfall thematisiert zu haben. Das ist mir immer wieder begegnet. Der Anteil Ostdeutscher in Spitzenpositionen ist immer noch verschwindend gering. Dabei ist eine Ost- oder Westidentität zunächst ja erst einmal keine eigene Entscheidung. Und dass es "Ossis" gibt, ist schließlich eine Erfindung des Westens.
DOMRADIO.DE: Das Erstarken der AfD in Ostdeutschland ist inzwischen ein gesamtdeutsches Phänomen. Was haben wir politisch falsch gemacht? Anders gefragt: Können Sie aus Ihrer Biografie heraus die AfD-Wähler auch ein Stück weit verstehen?
Lahl: Ich distanziere mich ausdrücklich und in aller Form von der AfD und verstehe die Menschen nicht, die AfD-Protestwähler sind. Gleichzeitig kann ich nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die einen Kanal suchen, wo sie ihre Wut und Unzufriedenheit artikulieren und loswerden können. Trotzdem ist deshalb nicht der ganze Osten rechtsradikal. Der Unmut der Bürger ist von der AfD – und das waren anfangs überwiegend Westdeutsche – aber enorm genutzt worden.
DOMRADIO.DE: Haben Sie eine Idee, wie man damit umgehen sollte?
Lahl: Zwei Dinge sind meines Erachtens in diesem Kontext ganz wichtig. Erstens: zuhören, reden lassen und echtes Interesse zeigen. Zweitens: die Ungerechtigkeit würdigen, die 1990 passiert ist. Es hätte eine Zeit geben müssen, wo man Eigentum hätte einfrieren sollen, anstatt Grundstücke, Häuser und Firmen von West-Investoren aufkaufen zu lassen. Die DDR-Bürger hatten damals kein Geld, etwas zu erwerben. Und dann kam ganz schnell die Treuhand. Da hätte es eine Zeit des geregelten Übergangs bedurft. "Es gibt keine andere Region in Europa, in der so wenig Grund und Boden den dort lebenden Menschen gehört wie in Ostdeutschland", sagt der aus Dresden stammende Schriftsteller Ingo Schulze.
Hinzu kommt, dass es ab 1990 – ich erwähnte es bereits – kaum Mitgestaltung und Teilhabe an der vereinigten Gesellschaft gab. Damit sage ich allerdings nichts Neues. Die Frage ist eher: Was kann heute konkret für die Gleichberechtigung von ost- und westdeutschen Bürgern getan werden?
DOMRADIO.DE: Wie sieht angesichts Ihrer Erfahrungen im Osten und Westen Deutschlands im Jahr 2023 Ihre persönliche Bilanz aus?
Lahl: Mein Schicksalskonto ist gefüllt. Ich habe alle Herausforderungen angenommen und kann heute mit einer gewissen Gelassenheit den Herbst meines Lebens angehen. Mein Lebensthema war immer, meinen Weg in diesem Spagat zu finden. Und das ist mir gelungen. Heute lasse ich mir von niemandem mehr die Flügel stutzen.
Das Interview führte Beatrice Tomasetti.