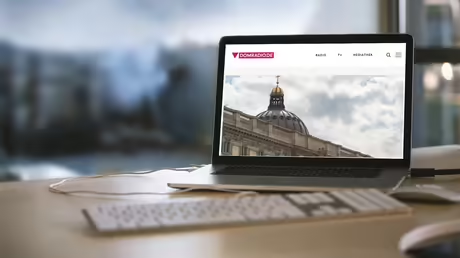Anstoß für die Klage des Schülers war folgende Szene, die sich vor drei Jahren am Diesterweg-Gymnasium abspielte: Der damals 14-jährige Yunus M. und einige seiner Freunde knien auf ihren Jacken und verrichten ihr Gebet. Ein Lehrer berichtete dies der Direktorin, die den Schüler belehrte, dass er in der Schule nicht beten könne. Während das Verwaltungsgericht Berlin dann im September der Argumentation des Schülers auf Religionsfreiheit folgte, entschied das OVG jetzt zugunsten der Schule und der Schulverwaltung.
Bei der Verkündung begründeten die Richter dies mit der Gefährdung des Schulfriedens. Wegen der Vielzahl der unterschiedlichen Religionsvertreter an dem Gymnasium könne es zu einer Art Wettbewerb zwischen den Religionen kommen. Der Schule seien Vorkehrungen, damit jeder Schüler ungestört beten könne, nicht zuzumuten. Zudem sei es - nach einem islamwissenschaftlichen Gutachten - erlaubt, dass Yunus M. das Mittags- und Nachmittagsgebet zusammenziehe.
"Hochproblematischen Entscheidung"
Rechtswissenschaftler sprechen jetzt von einer "hochproblematischen Entscheidung". Seiner Auffassung nach gebe es für das Urteil "keine tragfähige Begründung", sagt etwa der Göttinger Jurist Hans Michael Heinig der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Es sei fraglich, ob ein so massiver Eingriff in die Religionsfreiheit nicht einer eigenen gesetzlichen Grundlage bedürfe. Dabei verwies Heinig auf das Kopftuchurteil des Bundesverfassungsgerichts von 2003, das viele Länderparlamente zu gesetzlichen Regelungen.
Sehr problematisch sei auch, dass die Richter über die Auslegung islamischer Vorschriften entschieden, so Heinig. Dies sei etwa so, als entscheide ein Gericht über den Zölibat in der katholischen Kirche. Heinig ermutigte den Kläger deshalb zur Revision. Komme es nicht zu diesem Schritt, bedeute die Entscheidung in jedem Fall einen "strikten Marsch in den Laizismus". Schulen in Berlin und Brandenburg könnten sich darauf berufen, falls es wegen eines demonstrativen Gebets, das es im Islam nun einmal gebe, ihrer Meinung nach Konfliktpotential gebe. Fraglich sei dann auch, inwieweit Schulen dann etwa auch an einem Schülerbibelkreis Anstoß nehmen könnten.
Anderen Bundesländern sehen keinen Handlungsbedarf
Fest steht: Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts bezieht sich zunächst auf einen konkreten Einzelfall. Dennoch dürfte es für die vorwiegend muslimischen Schüler, die bereits Anträge auf ein öffentliches Mittagsgebet gestellt haben, mit dem Urteil deutlich schwerer werden.
Falls es rechtskräftig wird, muss die Berliner Schulverwaltung möglicherweise auch eigene Vorschriften überarbeiten. In ihren "Ausführungsvorschriften über den Religions- oder Weltanschauungsunterricht" vom Dezember 2007 heißt es, dass "die Schule zur Gestaltung von Andachten und Feierstunden in den Unterrichtsstunden des Religions- oder Weltanschauungsunterrichts oder in der unterrichtsfreien Zeit im Rahmen ihrer jeweiligen räumlichen Kapazitäten Räume kostenlos zur Verfügung" stellt.
In anderen Bundesländern sehen Schulverwaltungen in Sachen Gebetsausübung bislang keinen Handlungsbedarf. Dort würden pragmatische Lösungen gesucht, wenn gläubige Schüler beten wollten, ergab eine Umfrage von Berliner Zeitungen.
Nach dem Berliner Gebetsurteil gibt es starke Bedenken
"Strikter Marsch in den Laizismus"
Die Entscheidung sorgt für Wirbel: Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschied am vergangenen Donnerstag, dass ein muslimischer Schüler sein Gebet nicht außerhalb des Religionsunterrichts verrichten darf. Die Spekulationen über die grundsätzliche Bedeutung des Einzelfalls haben begonnen.

Share on