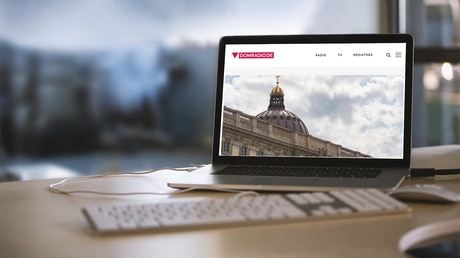Im Kollaps staatlicher Ordnung ermordeten Islamisten und kriminelle Banden bisher mehr als 1.000 Christen, viele wurden entführt, Kirchen gesprengt. Von den einst bis zu anderthalb Millionen Anhängern ihrer Religion, die meisten Chaldäer, ist der Großteil geflohen. Heute leben höchstens noch 400.000 Christen im Irak.
Während die westliche Öffentlichkeit den Exodus eher als Fußnote im irakischen Gesamtchaos wahrnimmt, haben katholische Hilfswerke früh die Verbindung zu den mit Rom unierten Bistümern gesucht. "Wir befürchteten von Anfang an, dass sich die Lage für die Christen zuspitzt", erinnert sich der Direktor des missionswissenschaftlichen Instituts missio, Harald Suermann. Doch bis heute gestalte sich die Kooperation mit den irakischen Diözesen schwierig. Eine von Suermann organisierte Konferenz, die an diesem Montag bei missio in Aachen beginnt, soll neue Impulse bringen.
Die hochkarätige Teilnehmerliste verspricht greifbare Ergebnisse. Neben Vertretern von missio, Misereor, Caritas International, Kirche in Not und dem Kindermissionswerk reisen aus dem Irak die Erzbischöfe von Bagdad, Mosul (der chaldäische und der syrisch-katholische) und Arbil an. Aus der irakischen Hauptstadt kommt auch Weihbischof Shlemon Warduni, rechte Hand des chaldäischen Patriarchen Emmanuel III. Delly. Der 84-jährige Patriarch galt oft als Skeptiker einer engen Zusammenarbeit mit den Brüdern aus dem Westen. "Die Chaldäer führen ein starkes Eigenleben", weiß Suermann. "Ihre Bistümer sind nicht so vernetzt, wie wir das aus Europa kennen. Das erschwert oft die Arbeit."
Aufbau eines gemeinsamen Organisationsbüros
Konkret geht es bei dem zweitägigen Treffen um den Aufbau eines gemeinsamen Organisationsbüros in Arbil, der Hauptstadt der kurdischen Autonomieregion im Nordirak. Es soll pastorale und Entwicklungshilfeprojekte koordinieren. "Das fängt schon damit an, dass wir beim Abfassen von Anträgen helfen, damit sie die Genehmigungsverfahren durchlaufen können", so Suermann. In der Vergangenheit hätten die Hilfswerke zuweilen dürre Dreizeiler erreicht, in denen Chaldäer etwa um ein Auto baten, damit ein Pastor seine weitverstreuten Gemeindemitglieder erreichen kann. Oft gehe es auch um Reparaturhilfen für Kirchenbauten.
Arbil wäre ein relativ sicherer Standort für das Büro. Die kurdische Autonomieregierung hat vielen Christen aus den arabischen Landesteilen Zuflucht gewährt, vor den Kirchen der Region sichert kurdische Peschmerga-Miliz die Gottesdienste. Anders als in Bagdad, Mosul oder Kirkuk sind islamische Fanatiker hier selten. Man hofft, dass der Westen das Streben nach einem kurdischen Staat unterstützt und setzt religiöse Toleranz als Werbemittel ein. "Außerdem sind etliche Christen noch aus der Saddam-Ära gut ausgebildet, es gibt viele Ärzte unter ihnen. Solche Leute sind willkommen", ergänzt Suermann. Doch genug andere sind wirtschaftlich nicht integriert und vegetieren in den Bergdörfern als Binnenflüchtlinge dahin. Gerade ihnen müsste das Hilfsbüro Perspektiven bieten.
Viel Zeit bleibt dafür nicht mehr, zumal die gelegentlich geäußerte Idee einer christlich-autonomen Zone in der Ninive-Ebene utopisch anmutet. Entscheidend ist, ob die verbliebenen Christen dauerhafte Sicherheitsgarantien erhalten. Die wird auch das kleine Arbiler Büro nicht verschaffen können. Die Frage ist vielmehr, wie sich die islamische Mehrheit zur Zukunft ihrer christlichen Minderheit stellt. Doch inmitten der mörderischen Konflikte zwischen Sunniten und Schiiten, Kurden und Arabern, hat ein breiter interreligiöser Dialog mit den Christen derzeit kaum eine Chance.
Bischöfe und Hilfswerke beraten über die Zukunft der Christen im Irak
Retten, was zu retten ist
Wer heute noch als Christ im Irak lebt, besitzt entweder viel Gottvertrauen oder keine Mittel, um das Land zu verlassen. Längst ist klar, dass sich die uralte christliche Kultur an Euphrat und Tigris nie mehr vom Sturm der Invasion von 2003 erholen wird. Eine Konferenz in Deutschland soll neue Impulse bringen.

Share on