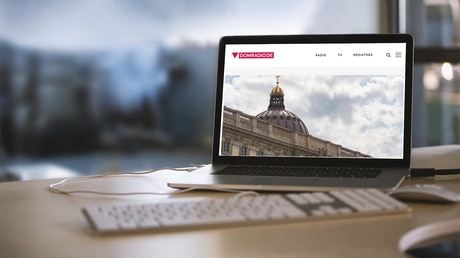Ausnahmezustand Corona-Krise: Seit langem hat sich die Gesellschaft nicht mehr so intensiv mit Alter, Versorgung von Sterbenden und Tod auseinandergesetzt. Corona ist hoffentlich bald Vergangenheit. Doch Sterben und Tod bleiben ein Zukunftsthema in der alternden Gesellschaft, wie eine am Donnerstag vorgestellte Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung deutlich macht.
Der demografische Wandel setzt das Thema auf die Agenda - weniger krisenhaft, aber dafür umso langfristiger. Und die Gesellschaft sollte sich darauf einstellen, so die Wissenschaftler unter der Überschrift "Auf ein Sterbenswort. Wie die alternde Gesellschaft dem Tod begegnen will".
Schon seit 1972 gibt es in Deutschland mehr Sterbefälle als Geburten. 2018 verzeichneten die Statistiker 955.000 Sterbefälle, mehr als 2.600 pro Tag. Dem standen 787.000 Geburten gegenüber, 2.100 pro Tag. Fest steht: Die Zahl der Sterbefälle wird weiter merklich steigen, weil jetzt die Babyboomer ins Rentenalter kommen.
Mit großen Auswirkungen auf das Denken der Deutschen, ihre Lebensgewohnheiten und die Infrastruktur. "Besonders in den ländlichen Regionen werden die Menschen häufiger an einer Trauerfeier teilnehmen, als die Geburt eines Kindes zu feiern", heißt es. In einigen Landkreisen dürften 2035 auf eine Geburt vier Beerdigungen kommen - heute sind es eins zu zwei.
Über Jahrzehnte sind Tod und Sterben weithin unsichtbar geworden. "Es wird für die Gesellschaft eine neue Normalität mit sich bringen, wenn fast ein Drittel ihrer Mitglieder in ein Alter kommt, in dem der Tod merklich näher rückt und schließlich unausweichlich wird", heißt es in der Studie. "Die Menschen werden zunehmend Angehörige und Freunde verlieren, und die Gesellschaft steht vor der Aufgabe, mehr Sterbende zu versorgen."
Zwischen Wunsch und Wirklichkeit
Dazu kommt, dass die "dritte Lebensphase", die mit dem Ruhestand beginnt, deutlich länger ausfällt als früher. Die Bürger haben mehr Zeit, sich mit dem Tod zu befassen. Und formulieren - oft jenseits der religiösen Traditionen - eigene Wünsche an Altsein und Sterben.
Der Wunsch nach Selbstbestimmung ist stark: Das zeigt aus Sicht der Wissenschaftler auch die Debatte über Sterbehilfe und Beihilfe zur Selbsttötung, die kein Tabu mehr sind.
Andererseits klaffen Wunsch und Wirklichkeit weit auseinander: Nach einer für die Studie in Auftrag gegebenen Allensbach-Umfrage möchten 76 Prozent im Kreis von Vertrauten sterben. Gleichzeitig steigt die Zahl der Singlehaushalte; Familien und Freunde wohnen immer öfter verstreut. Das "gute Sterben" ist fraglich: 74 Prozent der Befragten sorgen sich, dass Personal in Heimen und Krankenhäusern zu wenig Zeit hat, um sich um Sterbende zu kümmern. Einen einsamen Tod zu sterben, sehen 73 Prozent als weit verbreitetes Problem an.
Gefordert ist die Politik, besonders in den Kommunen. So stellt sich die Frage, ob ausreichend Ärzte, Krankenhäuser, Pflegekräfte und geeignete Wohnungen bereitstehen, um Alte und Kranke und ihre Angehörigen zu versorgen. Auch bei Hospizdiensten und Palliativmedizin gibt es Lücken. "Insbesondere die Bewohner entlegender Regionen sehen Versorgungsdefizite vor Ort", schreiben die Autoren.
Neue Gesprächsräume über Tod und Sterben
Aber auch die Bürger sind gefragt: Die Gesellschaft braucht nach Einschätzung der Studie mehr Austausch und neue Gesprächsräume über Tod und Sterben. Das seien noch "Nischenthemen". Drei von vier Befragten beklagen, dass das Thema verdrängt wird. Den Bedarf könnten und sollten alle Akteure - von den Medien, über Politik und Unternehmen bis hin zu Kirchen und Zivilgesellschaft - aufgreifen.
"Wir müssen neue Gesprächsanlässe schaffen", heißt es. Die Vorschläge reichen von Ausstellungen und Kunstprojekten über Besuche von Schulklassen in Beerdigungsinstituten bis zur Friedhofsgestaltung oder der Förderung von Hospizvereinen.
Und die Sterbebegleitung muss verbessert werden. Die Mehrheit der Menschen sei bereit, sich um sterbende Angehörige oder Freunde zu kümmern, allerdings ist jeder Vierte noch unentschlossen. Die Begleiter brauchen aber Wissen und auch Entlastung - palliative Dienste, das soziale Umfeld und Arbeitgeber sollten dafür sorgen.
Ziel muss laut Studie eine neue "Sorgekultur" sein.