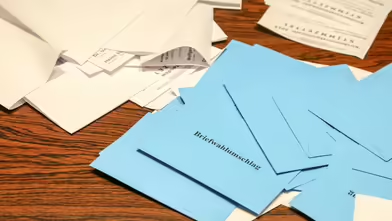Wie umgehen mit Gemeindemitgliedern, die in der AfD sind? Diese Frage beschäftigt immer mehr katholische Bistümer in Deutschland – besonders in Bezug auf Kirchenwahlen. So trat erst vor rund einer Woche im Erzbistum Berlin eine neue Wahlordnung für Pfarrei- und Gemeinderäte in Kraft:

Wer künftig für diese Ämter kandidiert, muss eine Erklärung gegen Rassismus und Antisemitismus unterschreiben. Und: Eine Mitgliedschaft in Parteien, die der zuständige Verfassungsschutz als extremistisch einstuft, ist laut Erklärung mit diesen Ämtern nicht vereinbar.
Damit entsteht im Erzbistum, das sich über drei Bundesländer erstreckt, eine kuriose Situation für die kommende Wahl im November: In Brandenburg können etwa AfD-Mitglieder nicht für das kirchliche Gremium kandidieren, da der dortige AfD-Landesverband vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft ist.
AfD-Mitglieder in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern aber, deren Landesverbände nicht so eingestuft sind, können kandidieren. Das Erzbistum Berlin ist dabei nicht das einzige Bistum, das inzwischen eine solche Erklärung eingeführt hat, wie eine Umfrage der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) unter allen 27 Bistümern ergab.
Erklärung fast im ganzen Osten nötig
In Ostdeutschland fordern auch die Bistümer Erfurt (seit 2025) und Magdeburg (2024) eine Unterschrift unter einer inhaltlich identischen Erklärung, wie sie in Berlin nun gilt. Während in diesen beiden Bistümern die Regel auch für die Kirchenvorstände gilt, die unter anderem das Vermögen der Pfarrei verwalten, fehlt eine solche Regelung bislang für das Erzbistum Berlin; ist aber nach Angaben des Pressesprechers angestrebt.
Im Bistum Dresden-Meißen findet sich mit der Ablehnung einer "wahrnehmbaren Mitgliedschaft oder Amtsübernahme in extremistischen Parteien oder Organisationen" seit 2024 eine ähnliche Erklärung, die unterschrieben werden muss.

Kirchenvorstandsmitglieder müssen allerdings nur unterzeichnen, den Dienst gewissenhaft zu erfüllen. Das Bistum Görlitz hat laut eigenen Angaben noch keine vergleichbare Erklärung - jedoch werde derzeit eine Aufnahme entsprechender Bestimmungen in die Wahlordnung geprüft.
Unterschiede in Formulierungen
Beim Blick auf weitere Bistümer, die ebenso Unterschriften fordern, fallen Unterschiede in den Formulierungen auf. Während etwa das Erzbistum Köln mit der Ablehnung einer "öffentlich wahrnehmbaren Mitgliedschaft" in Gruppen mit extremistischen Ansichten eine ähnliche Erklärung wie Dresden-Meißen nutzt, formulieren andere Bistümer ihre Erklärungen vergleichsweise schwächer.

So müssen Kandidaten in Aachen den Satz unterschreiben, dass sie generell "keiner kirchenfeindlichen Betätigung" nachgehen, die die Glaubwürdigkeit der Kirche beeinträchtigt.
Andere Bistümer, darunter Essen, fordern eine Unterschrift unter die zunächst sehr allgemeine Versicherung, die jeweils geltenden Wählbarkeitsvoraussetzungen der Wahlordnungen und Satzungen zu erfüllen. Konkret wird es dann erst beim Blick in die Satzungen:
Dort ist verankert, dass die Kandidaten "keiner kirchenfeindlichen Betätigung" nachgehen dürfen. Laut dem Erzbistum Paderborn, das ebenfalls diesen Passus verwendet, zielt der Text insbesondere auf Personen, die in extremistischen Parteien aktiv sind.
Verweis auf Statuten und Satzungen
Die Bistümer, die keine gesonderten schriftlichen Erklärungen gegen Rassismus und extremistische Parteien nutzen, verweisen auf ihre Satzungen, Statuten und Wahlordnungen. Diese deckten das Thema bereits ab. Die Passagen sind je nach Bistum mal konkreter, mal allgemeiner verfasst.
Das Erzbistum München und Freising etwa hat 2025 eine neue Präambel für alle Satzungen eingeführt, nach der Diskriminierung aufgrund von Herkunft, Hautfarbe oder Geschlecht unvereinbar mit einer Mitgliedschaft in den Katholikenräten ist.
In Augsburg besagen die Statuten, dass Menschen, die sich "im offenen Gegensatz zu der Lehre oder den Grundsätzen der römisch-katholischen Kirche befinden", nicht wählbar sind. In Bamberg sind laut Satzung Personen ausgeschlossen, die "öffentlich durch Wort, Schrift oder Tat dem Weltbild des christlichen Glaubens widersprechen".
Rechtliche Bedenken und Ausschluss-Regel
Eine andere Begründung für einen Verzicht auf eine gesonderte Erklärung führt das Bistum Würzburg an - rechtlich sei eine solche Erklärung wie in Berlin leicht angreifbar und nicht durchsetzbar. Passau verweist auf einen möglichen Ausschluss von Mitgliedern bei der "Verbreitung von Ideologien und/oder dem Eintreten für Organisationen, die mit den Werten und Prinzipien des Christentums unvereinbar sind".

Ähnlich antwortete das Bistum Limburg. Laut Synodalordnung können Mitglieder aus Gremien ausgeschlossen werden. Diese Regelung biete eine rechtliche Handhabe für Fälle von Rassismus oder Antisemitismus. Auf zusätzliche Verpflichtungserklärungen sei bewusst verzichtet worden. Es sollten demnach keine formalen Hürden geschaffen werden, sondern das Bistum habe auf bestehende rechtliche Instrumente und das Verantwortungsbewusstsein der Beteiligten gesetzt.
Keine "Gesinnungsprüfungen"
Bewusst auf eine Erklärung verzichtet auch das Bistum Trier. Zum einen verweist eine Sprecherin auf das Wahlrecht im Bistum, in dem eine Person bei "kirchenfeindlichen Betätigungen" nicht wählbar ist. Zum anderen verweist sie auf eine Aussage des Generalvikars Ulrich von Plettenberg.
Vor einem Jahr sagte dieser dem Portal katholisch.de, dass Trier keine Pläne für eine gesonderte Erklärung habe: "Wir machen keine 'Gesinnungsprüfungen', das widerstrebt mir."
Noch nicht eingeführt, aber entweder geplant oder ergebnisoffen im Rahmen kommender Wahlen oder Satzungsänderungen geprüft wird den Angaben zufolge die Einführung einer Erklärung in den Bistümern Hildesheim, Eichstätt und Speyer. Das Bistum Fulda und das Erzbistum Hamburg teilten mit, dass für die kommenden Wahlen im Jahr 2027 die Regularien noch erarbeitet werden.