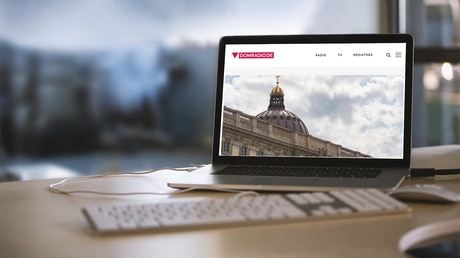Bayern und 249 Abgeordnete der CDU/CSU klagten in Karlsruhe. Im Mai 1993 kippte das Bundesverfassungsgericht die Regelung mit der Begründung, das Grundgesetz verpflichte den Staat, menschliches Leben - auch das des ungeborenen - zu schützen. Die Richter rügten auch das Beratungskonzept, da es keinen Auftrag enthielt, "die schwangere Frau zum Austragen des Kindes zu ermutigen". So ging die Debatte um den Schwangerschaftsabbruch in eine neue Runde und mündete im Juni 1995 in das heute noch gültige "Schwangeren- und Familienhilfe-Änderungsgesetz". Demnach ist ein Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich rechtswidrig, er bleibt jedoch straflos, wenn er in den ersten zwölf Wochen vorgenommen wird. Ausdrücklich nicht rechtswidrig ist eine Abtreibung nach einer Vergewaltigung oder bei Gefahr für das Leben oder die körperliche oder seelische Gesundheit der Schwangeren. Zudem muss die Frau sich mindestens drei Tage vorher beraten lassen. Die Beratung muss ergebnisoffen geführt werden, soll jedoch dem Schutz des Lebens dienen.
Lebensrecht des ungeborenen Kindes gegen Selbstbestimmungsrecht der Frau: Seit 1871 stellte der Paragraf 218 Abtreibung unter strenge Zuchthaus-Strafe. 1926 wurde das Wort "Zuchthaus" durch "Gefängnis" ersetzt und die "medizinische Indikation" zugelassen, also der Schwangerschaftsabbruch bei Gesundheitsgefährdung der Mutter. 1972 führte die DDR eine Fristenlösung ein. 1974 beschloss auch die Bonner sozial-liberale Koalition eine Fristenlösung, die eine legale Abtreibung während der ersten drei Schwangerschaftsmonate vorsah. Sie scheiterte damit auf Antrag der Union 1975 in Karlsruhe.
1999 folgte das Aus für die kirchliche Schwangerenkonfliktberatung im staatlichen System
Ein Jahr später beschloss der Bundestag ein Gesetz, das den Schwangerschaftsabbruch zwar prinzipiell für strafbar erklärte, Fälle, in denen eine medizinische, kriminologische, soziale oder eugenische Indikation vorlag, aber ausnahm. Diese Regelung blieb umstritten: Ärzte legten insbesondere die soziale Indikation zunehmend weiter aus, sodass bereits Arbeitslosigkeit als Begründung ausreichte. Der Fall der Mauer brachte das Thema dann erneut auf die Tagesordnung. Der Einigungsvertrag verlangte, dass ein gesamtdeutscher Bundestag bis Ende 1992 ein einheitliches Gesetz schaffen müsse.
Im Bundestag wurde im Frühsommer 1992 mit harten Bandagen gekämpft. Es gab mehr als 100 Wortmeldungen. Die Grünen forderten die Legalisierung der Abtreibung ohne Frist, die Union war uneins: Ein Teil verlangte ein völliges Verbot. Ein anderer Teil stimmte mit FDP und SPD. Auch außerhalb des Parlaments schlugen die Wogen hoch: Der Fuldaer Erzbischof Johannes Dyba sprach vom "Kinder-Holocaust". Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein unkte, Deutschland treibe "auf einen Kirchenkampf zu". Besonders in der Kritik der Kirche stand Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth, die für den letztlich erfolgreichen Gruppenantrag von SPD und FDP warb. CSU-Politiker forderten den Rücktritt der Katholikin.
Es war das erste Mal in der bis dahin knapp zehnjährigen Regierungszeit unter Helmut Kohl, dass die Union eine Abstimmung verlor. Bis Karlsruhe dann anders entschied. Mit dem "Schwangeren- und Familienhilfe-Änderungsgesetz" von 1995 beruhigte sich die Lage zumindest politisch und rechtlich. Die katholische Kirche allerdings fand sich nicht damit ab, die für eine Abtreibung notwendigen Beratungsscheine ausstellen zu müssen. Ende 1999 verkündeten die Bischöfe das Aus für die kirchliche Schwangerenkonfliktberatung im staatlichen System.
Lebensschützer ziehen negative Bilanz
20 Jahre nach dem Bundestagsbeschluss haben Lebensschützer eine negative Bilanz gezogen und eine Nachbesserung des Paragraphen 218 gefordert. Das vom Gesetzgeber damals einführte Konzept "Hilfe statt Strafe" sei gescheitert. Das belegten schon die jährlichen Abtreibungszahlen, erklärte die Aktion Lebensrecht für Alle (ALfA) am Dienstag in Köln. Da insgesamt die Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter stärker zurückgegangen sei als die Zahl der gemeldeten Abtreibungen, trieben Frauen heute häufiger ab als vor der Regelung.
Die ALfA-Vorsitzende Claudia Kaminski kritisierte zudem, dass die dem Gesetzgeber vom Bundesverfassungsgericht auferlegte Beobachtungs- und Nachbesserungspflicht nie in Angriff genommen worden sei. "Für weite Teile der Bevölkerung stellt eine vorgeburtliche Kindstötung kein Unrecht mehr dar", sagte sie. Dass Abtreibungen in den allermeisten Fällen rechtswidrig seien, sei bei vielen Bürgern nie angekommen. Mitverantwortlich sei dafür, dass der Staat die "rechtswidrigen", aber "straffreien" Kindstötungen mit Steuergeldern aus den Länderhaushalten subventioniere.
Vor 20 Jahren verabschiedete der Bundestag ein neues Abtreibungsrecht
Lebensrecht gegen Selbstbestimmungsrecht
Gesucht wurde eine gesetzliche Regelung der Abtreibung für das wiedervereinigte Deutschland: Am 26. Juni 1992 rang sich der Bundestag zu einer Fristenlösung mit Beratungspflicht durch. Demnach galt ein Abbruch in den ersten zwölf Wochen nicht als rechtswidrig, wenn sich die betroffene Frau zuvor beraten ließ. Doch die Entscheidung hatte nicht lange Bestand.

Share on