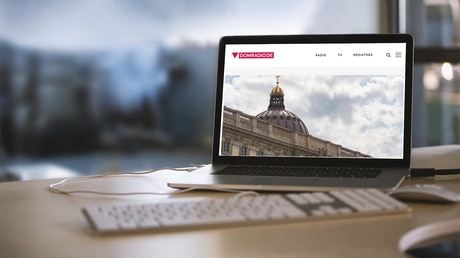Langfristig sei es nicht möglich für 400.000 Menschen eine selbstständige Existenz in der Landwirtschaft zu schaffen, meint Dieckmann. Eine politische Lösung müsse her, damit gerade Somalier in ihr Land zurückkehren könnten. "Das werden die UN versuchen müssen, das wird vor allem aber die afrikanische Union selbst machen: Einfluss darauf nehmen, dass eine stabile Übergangsregierung in Somalia ist und dass nicht aus anderen Ländern die islamistischen Milizen in Somalia finanziert werden", mahnt Dieckmann am Donnerstag im domradio.de-Interview.
Schätzung: Zwölf Millionen Menschen insgesamt betroffen
Die Lage in dem Lager beschreibt sie als "bedrückend". Die Menschen lebten "in für uns unvorstellbaren Umständen". Hitze, Staub und Sand seien überall präsent. Viele Frauen seien mit ihren Kindern allein gekommen. In dem Lager würden sie versorgt und bekämen eine Grundernährung. "Es geht nicht nur um die 400.000 in dem Flüchtlingslager, es sind ja zwölf Millionen Menschen insgesamt betroffen", gibt Dieckmann zu bedenken.
Die Präsidentin der Welthungerhilfe hat Bundesentwicklungsminister Dirk Niebel (FDP) nach Dadaab begleitet. Sie fordert von der deutschen Entwicklungszusammenarbeit eine stärkere Förderung der ländlichen Entwicklung, hofft aber auch auf die Hilfsbereitschaft afrikanischer Länder.
Die Hungerproblematik müsse stärker auf die politische Agenda gesetzt werden und auch die Wassersicherung müsse stärker als bisher in den Blick genommen werden. Für Dieckmann steht aber auch fest, "dass mit dem Klimawandel es auch die ein oder andere Region in der Welt gibt, die in Zukunft nicht mehr Leben für Menschen ermöglicht".
Keine Linderung in Sicht
In Somalia zeichnet sich nach wie vor keine Linderung der Hungerkrise ab. Bis zu 400.000 Kinder seien akut vom Tod bedroht, wenn die Hilfe nicht verstärkt werde, warnte der britische Entwicklungsminister Andrew Mitchell am Donnerstag nach einem Besuch in der Hauptstadt Mogadischu. Nach Angaben der Diakonie Katastrophenhilfe strömen weiter Flüchtlinge in die Millionenstadt. Der Hunger sei in Mogadischu allgegenwärtig. "Tausende Menschen drängen aus den Dürregebieten in die Stadt und erzählen, dass sie aus Dörfern kommen, in denen niemand mehr ist", sagte der Sprecher des evangelischen Hilfswerks, Rainer Lang, in Mogadischu in einem telefonischen epd-Gespräch. Der Bedarf an Hilfsgütern sei sehr groß und könne bislang nicht gedeckt werden.
In Rom berieten auf Einladung der UN-Ernährungsorganisation internationale Agrarexperten über die Lage am Horn von Afrika. Der britische Minister Mitchell kündigte weitere 29 Millionen Euro für die Hungerhilfe in Somalia an. Es sei ein Wettlauf mit der Zeit, sagte Mitchell nach seiner Rückkehr.
In Somalia habe er deutlich gemacht, dass die britische Regierung keinerlei Korruption bei Hilfslieferungen dulde. Premierminister Abdiwell Mohamed Ali habe zugesagt, entsprechenden Berichten nachzugehen. Laut dem somalischen Internet-Portal "Shabelle" versprach Ali eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Plünderungen und Unterschlagungen.
Druck auf Nigeria und Südafrika wächst
Angesichts der Katastrophe infolge einer schweren Dürre wächst in ganz Afrika der Druck auf die Regierungen, sich stärker an den Hilfen für die Dürreopfer zu beteiligen. "Länder wie Nigeria, Südafrika oder Algerien sollten problemlos mindestens sechs Millionen US-Dollar aufbringen können", sagte der Afrika-Direktor der Hilfsorganisation Oxfam, Irungu Houghton, in Nairobi dem epd.
Bislang hätten erst vier afrikanische Staaten überhaupt Hilfen zugesagt. Mit einer Million Dollar ist Südafrika der größte afrikanische Geber. Mit der von Oxfam unterstützten Kampagne "Africans Act for Africa" fordern Künstler, Intellektuelle und einfache Bürger von den Regierungen einen Beitrag von mindestens 50 Millionen US-Dollar (35 Millionen Euro) für die insgesamt zwölf Millionen Hungernden am Horn von Afrika.
Weltweit erhielten die UN bisher Zusagen über eine Milliarde US-Dollar (700 Millionen Euro). Es fehlen aber noch 1,4 Milliarden Dollar (980 Millionen Euro), die am Mittwoch von der Organisation Islamischer Staaten zugesagten 350 Millionen Dollar noch nicht mitgerechnet.
Somalia: Milizen erschweren UN den Zugang
Im Bürgerkriegsland Somalia ist die Lage am schlimmsten. Die Hilfe wird erschwert durch Kämpfe zwischen islamistischen Milizen und Regierungstruppen, die von einer Eingreiftruppe der Afrikanischen Union unterstützt werden. Zudem verwehren die Milizen dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen den Zugang zu vielen Gebieten.
"In den von den Islamisten kontrollierten Gebieten gibt es kaum Lebensmittel und vor allem keine medizinische Versorgung", berichtete Diakonie-Sprecher Lang. Die Kämpfer zogen vor knapp zwei Wochen aus Mogadischu ab, hinterließen aber Widerstandsnester. "Einige der von Al-Schabaab verlassenen Viertel sind Geisterstädte, und das Ausmaß der Zerstörung ist unglaublich."
Lang zufolge hausen viele Flüchtlinge unter Stofffetzen und Plastikplanen zwischen Ruinen. "Auch in der Kathedrale, die von den Kämpfen völlig zerstört ist, leben Menschen", berichtete er. Hilfswerke berichten auch von einem Ausbruch der Cholera in Mogadischu. Am Donnerstag war von mehr als 4.000 bestätigten Fällen die Rede.
Welthungerhilfe fordert politische Lösung für Ostafrika
Hitze, Staub und Sand
Nur eine politische Lösung kann den Menschen in den Dürreregionen Ostafrikas dauerhaft helfen. Zu diesem Fazit kommt die Präsidentin der Welthungerhilfe, Bärbel Dieckmann, nach ihrem Besuch in Dadaab. Im domradio.de-Interview spricht sie über das größte Flüchtlingslager der Welt.

Share on