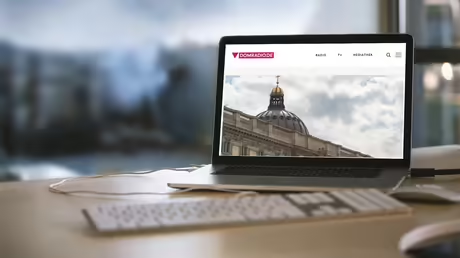Der vielleicht interessanteste Satz aus der Perspektive der Kirchen steht im Urteil zu dem Mormonen. Ihm wurde als Leiter der Öffentlichkeitsarbeit für Europa gekündigt, nachdem er seinen Vorgesetzten eine außereheliche Beziehung offenbart hatte. Im Urteil heißt es, die deutsche Arbeitsgerichtsbarkeit habe ausreichend belegt, dass die dem Beschäftigten auferlegten Loyalitätspflichten akzeptabel seien; diese hätten zum Ziel, die Glaubwürdigkeit der Glaubensgemeinschaft zu bewahren.
Die Richter billigen ausdrücklich auch die folgende Argumentationskette deutscher Arbeitsgerichte: Zwar stelle Ehebruch nicht immer einen ausreichenden Kündigungsgrund für den Beschäftigten einer Religionsgemeinschaft dar. Bei dem betroffenen Mormonen sei dies aber zum einen wegen der Schwere des Verstoßes in den Augen der Glaubensgemeinschaft und wegen der von ihm bekleideten wichtigen Position der Fall. Weil all diese Argumente ordentlich abgewogen worden seien, verstoße seine Kündigung nicht gegen die Europäische Menschenrechtskonvention.
Zu einem anderen Schluss kamen die Straßburger Richter im Fall eines katholischen Kirchenmusikers, dem das Bistum Essen gekündigt hatte. Der Organist und Chorleiter hatte sich in Deutschland vergeblich gegen die Entlassung gewehrt. Sie war ausgesprochen worden, nachdem er sich zunächst von seiner Frau getrennt hatte und seine neue Partnerin dann ein Kind von ihm erwartete. In Deutschland blieben seine Beschwerden bis zum Bundesarbeits- und Bundesverfassungsgericht erfolglos.
Ausdrücklich verwahrt sich der Menschenrechtsgerichtshof nun gegen die Rolle, Schiedsrichter für das Verhältnis von Staat und Kirche in den 47 Europarats-Mitgliedstaaten zu sein. "Wenn Fragen des Verhältnisses von Staat und Kirche zur Debatte stehen, in denen es vernünftigerweise in einer demokratischen Gesellschaft tiefgreifende Meinungsunterschiede geben kann, ist es erforderlich, den nationalen Entscheidungsinstanzen eine besondere Rolle zukommen zu lassen", heißt es in der Entscheidung.
Die Straßburger Richter kritisierten aber, die deutschen Gerichte hätten es sich in ihren Urteilen zu dem Organisten zu einfach gemacht. Sie hätten mehr oder weniger ungeprüft die Argumentation der Kirche übernommen, eine Weiterbeschäftigung des Organisten würde zum Verlust ihrer Glaubwürdigkeit führen. Die Gerichte hätten es unterlassen, die Verhältnismäßigkeit der Kündigung und die Nähe des Betroffenen zum kirchlichen Verkündigungsauftrag zu prüfen. Zudem hätten die Arbeitsgerichte auch gar nicht die Folgen der Kündigung mit Blick auf das Recht auf Privat- und Familienleben bewertet. Die Interessen des kirchlichen Arbeitgebers seien lediglich gegen das Interesse des Betroffenen abgewogen worden, seinen Arbeitsplatz zu erhalten.
Auch nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Selbstbestimmungsrecht der Kirchen von 1985 umfasse die kirchliche Autonomie nicht das komplette Privatleben ihrer Beschäftigten, so das Menschenrechtsgericht. Deutschland habe daher durch seine Rechtsprechung die Europäische Menschenrechtskonvention verletzt und das Recht des Gekündigten auf Achtung seines Privat- und Familienlebens missachtet.
Noch steht die Entscheidung aus, ob der Mann Schadenersatz erhält. Der gekündigte Kirchenmusiker hatte mehr als 300.000 Euro als Ersatz für entgangenen Verdienst verlangt. Die Bundesregierung wies die Forderung in Straßburg zurück. Sie machte geltend, der Mann könne - falls der Menschenrechtsgerichtshof zu seinen Gunsten entscheide - eine Neuaufnahme des Verfahrens in Deutschland verlangen. Zudem sei nicht sicher, dass er ununterbrochen weiter in der Pfarrei beschäftigt geblieben wäre. Die Straßburger Richter gaben den Streitparteien drei Monate Zeit, sich zu einigen.
Menschenrechtsgericht gibt gekündigtem Kirchenmusiker Recht
Urteil mit Folgen?
Die Sonderstellung der Kirchen und Religionsgemeinschaften im deutschen Arbeitsrecht ist vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof nicht grundsätzlich infrage gestellt worden. Zwar gaben die Richter am Donnerstag in Straßburg einem gekündigten katholischen Kirchenmusiker Recht. Zugleich verwarfen sie aber die Beschwerde eines Mormonen.

Share on