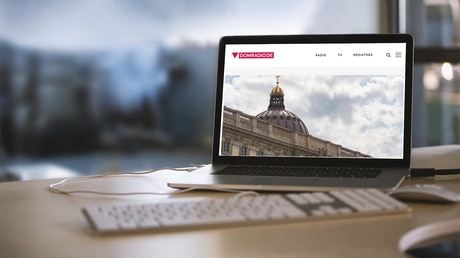Die Auseinandersetzung über Wunder erhielt bei den 66. Filmfestspielen in Venedig sowohl den Signis-Preis der ökumenischen Jury wie den Brian-Award der Religionskritiker, benannt nach Monty Python's Jesus-Satire "Life of Brian".
Die Handlung spielt auf einer Wallfahrt des Malteser-Ordens nach Lourdes. 1858 erschien dort die Gottesmutter dem Bauernmädchen Bernadette Soubirous. Nach ersten Heilungen entwickelte sich der Ort zu einer der größten Wallfahrtstätten der Christenheit mit jährlich mehrere Millionen Pilgern. Zu ihnen gehört auch die Hauptfigur von Hausners Film, Christine - beeindruckend gespielt von Sylvie Testud.
Der Film gibt keine abschließende Antwort
Die junge Frau leidet an Multipler Sklerose und ist an den Rollstuhl gefesselt. Sie hofft weniger auf ein Wunder, sondern mehr, ihre unfreiwillige Isolation zu überwinden. Nach Besuchen in der Grotte und Bädern bessert sich Christines Befinden überraschend. Sie kann wieder laufen. Das Ärztekomitee von Lourdes prüft, ob ein Wunder vorliegt. Das Ergebnis bleibt offen, da die Krankheit vorübergehende Besserungsschübe kennt.
Auch der Film gibt keine abschließende Antwort. Hausner geht es um die Ambivalenz zwischen der kirchlichen Überzeugung, wonach Gott durch Wunder heilend in das Leben von Menschen eingreifen kann und dem grundsätzlichen Zweifel am Glauben. Damit wirft sie zugleich zentrale Fragen nach der Existenz Gottes, der Sehnsucht nach Glück und Heil auf der einen Seite und der Erfahrung von Krankheit, Zufall und Unheil auf der anderen Seite auf.
Das Werk ist formal streng gehalten, die Personen und die Riten einer Pilgerwalfahrt werden fast dokumentarisch beobachtet. Die Kamera wahrt beobachtende, erkundende Distanz. Schon die erste Szene zum Frühstück im Pilgerhospiz wirkt wie die Sequenz einer Überwachungskamera. Bei Schuberts "Ave Maria" kommen die Pilger nach und nach in den schmucklosen Kantinenraum. Die Bilder sind leicht entfärbt. Die Außenaufnahmen erinnern an ausgebleichte Fotos aus den 60er Jahren.
Milieustudie
So wird der Film zur Milieustudie. Die unterschiedlichen weltanschaulichen Perspektiven übernehmen die Teilnehmer der Pilgergruppe: Die Mutter, die mit ihrer kranken Tochter alljährlich nach Lourdes kommt und nun erleben muss, dass ausgerechnet eine wenig gläubige MS-Kranke geheilt wird; freiwilligen Helfer, die sich offenbar eher nach Ferien sehnen - was dem Engagement der Malteser nicht wirklich gerecht wird. Zwei Tratsch-Tanten, die Geschwätziges zum Besten geben... Und natürlich fehlt der Priester nicht. Gesellig, bodenständig kümmert er sich aufmerksam um die Pilger.
"Ich habe mir vorgestellt, mich diesem sehr ambivalenten Ort eher wie ein japanischer Forscher zu nähern", erläuterte Hausner in Venedig. Tatsächlich entsteht bei aller scheinbar dokumentarischen Lebensnähe eine aseptische Laboratmosphäre. Jeder hat seine Rolle in einer präzisen Choreographie. Entsprechend erscheinen die Antworten des Geistlichen oft allzu abstrakt. Vor allem aber erspart Hausner ihrer Protagonistin eine wirkliche Entscheidungssituation. Sie habe versucht "das Wunder so unwunderlich wie möglich zu erzählen" meint sie. In der Tat bleibt Christines Reaktion auf die Heilung seltsam zurückhaltend, leidenschaftslos. Ja, sie kann sich offenbar mehr über ein Fruchteis in der Sonne freuen als über die wiedergewonnene Beweglichkeit.
Zum Wunder gehört aber, dass der Mensch aus körperlicher oder seelischer Not unerwartet herausgerissen sich zunächst auch emotional überwältigt sieht. Erst dann versucht er, das Geschehen rational oder spirituell tiefer zu verstehen. In "Lourdes" ist die Reflexion dem Wunder aber immer schon voraus - was eine existenzielle Auseinandersetzung letztlich verhindert.
Am Donnerstag kommt der Film "Lourdes" in die Kinos - Regisseurin im Interview
Wunder in Laboratmosphäre
Selten wird ein Drama über Glaubensfragen von Gläubigen wie Atheisten prämiert. Das Kunststück gelang Jessica Hausner mit ihrem jüngsten Film "Lourdes", der am Donnerstag in die deutschen Kinos kommt. Im domradio.de-Interview spricht die österreichische Regisseurin über ihren Film: "Es geht um die Metapher 'Wunder'."

Share on