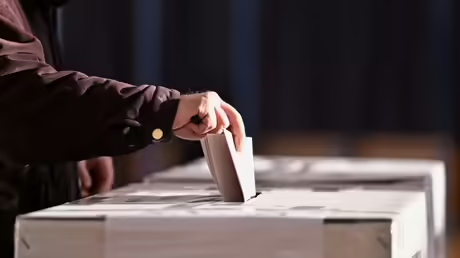Katholischen Gemeindepfarrern in Deutschland kommt in der Regel eine Doppelfunktion zu: Es ist ihre Aufgabe, den Glauben zu verkünden, die Messe zu leiten und Sakramente zu spenden. Daneben wird von ihnen auch die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben erwartet: Sie sitzen in Kirchenvorständen, entscheiden mit über Finanzen, Personal sowie die Nutzung der mancherorts nicht wenigen Grundstücke der Kirchengemeinde.
Diese spirituelle und administrative Doppelaufgabe erfordert Kompetenzen, die jedoch offensichtlich in der Priesterausbildung bislang zu wenig berücksichtigt werden. So lautet zumindest eines der Ergebnisse der am Freitag vorgestellten Studie "Wer wird Priester?" der Deutschen Bischofskonferenz.
Dafür hatte das Bochumer Zentrum für angewandte Pastoralforschung (zap) im Auftrag der Bischofskonferenz 2.515 Personen zur Befragung eingeladen, darunter alle 847 Priester, die zwischen 2010 und 2021 geweiht wurden, sowie alle 1.668 Männer, die in diesem Zeitraum das Priesterseminar verlassen haben. Teilgenommen an der Online-Umfrage haben zwischen Oktober 2021 und Februar 2022 letztlich 153 geweihte Priester sowie 18 Seminarabbrecher.
Großer Wunsch nach Spiritualität
Bei den Ansprüchen, die die Teilnehmer an ihre Ausbildung hatten, stehen demnach die eigene Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität mit jeweils 71,7 und 63,2 Prozent recht weit oben auf der Liste. Auch die seelsorgerische Begleitung wird mit 69,1 Prozent als sehr wichtig wahrgenommen. Aufgaben des Gemeindemanagements liegen dagegen weit dahinter zurück: Nur 39,5 Prozent wünschten sich etwa mehr Gewichtung für die Einführung in die kirchliche Verwaltung.
Was das schließlich für die Arbeit vor Ort bedeutet, zeigt sich in der Studie: Gefragt nach ihren Schwerpunkten in der Ausbildung, sagten nur 6,1 Prozent, dass sie sie in praktischen Belangen sehr gut vorbereitete habe. 30,4 Prozent bewerteten sie immerhin noch als gut, 22,3 Prozent jedoch als schlecht und 5,4 Prozent sogar als sehr schlecht. Ein umgekehrtes Bild bei der theologischen Ausbildung: Diese wird von 36,2 Prozent als sehr gut sowie von 45 Prozent als gut wahrgenommen - bei nur 0,7 Prozent, die sie als sehr schlecht bezeichnen.
"Überforderung ist vorprogrammiert"
Ziel der Studie sollte es sein, sowohl eine empirische Erhebung von Herkunft und Motivation aktueller Priester - und derer, die das Seminar verlassen haben - sowie Empfehlungen an die künftige Planung der Berufungspastoral zu erstellen. Dabei habe sich "eine starke Notwendigkeit zum Umsteuern in der Berufungspastoral und der Priesterausbildung" offenbart, sagte der Leiter des zap, Matthias Sellmann.
Die Motivation für die Berufung entspreche offenbar in vielen Fällen nicht den Anforderungen, die in Gemeinden vor Ort gestellt würden. Gerade junge Priester liefen dadurch Gefahr, nach der Übernahme ihrer Stelle «ins offene Messer zu laufen», warnte der Theologe. "Viele wollen Seelsorger sein, sie wollen aber nicht Chef sein und schon gar nicht Manager."
Sellmann kritisierte, dass bislang keine Bestrebungen zu erkennen seien, die auf eine Überarbeitung des Priesterbildes in der Ausbildung hindeuteten. Für die Kirche in Deutschland könne das weitreichende Folgen haben, da sich aus dem kleiner werdenden Pool der geweihten Priester auch die Bischöfe als oberste Entscheidungsträger rekrutierten. "Ihre Überforderung im Ausfüllen von Führungspositionen ist vorprogrammiert."
Folgen für den Synodalen Weg
Insbesondere auf den Reformdialog der Kirche in Deutschland, den Synodalen Weg, an dem Sellmann selbst als Teilnehmer mitwirkte, werde das Auswirkungen haben. Das zeigt auch die Frage danach, was genau auf der Reformagenda stehen müsse. Zwar sagten nur 4,6 Prozent, dass Reformen nicht nötig seien, die Mehrheit fokussierz sich dabei aber auf spirituelle Fragen, wie es hieß. So sagten über 80 Prozent, dass es mehr Angebote mit spirituellem Tiefgang brauche, drei Viertel wünschten sich eine stärkere Ausrichtung auf die Vermittlung von Glaubensinhalten.
Hingegen meinten jeweils nur rund 30 Prozent, dass es eine Reform der kirchlichen Amtsautorität brauche oder das der Zölibat abgeschafft werden müsse. Gerade letzterer Befund ist dabei für den Hintergrund interessant, dass rund 73 Prozent Ehelosigkeit und Zölibat als maßgebliche Hindernisse für die Entscheidung zum Priesteramt betrachten.
Und schließlich noch die Frage nach dem Frauenpriestertum: Nur ein Viertel der befragten Priester hält dieses zentrale Anliegen des Synodalen Weges in Deutschland für ein notwendiges Unterfangen zur Kirchenreform. Die Priester seien also "nicht Mitträger des Synodalen Weges in Deutschland".
Der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Michael Gerber, begrüßte zwar den stärkeren Wunsch nach einer größeren Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität in der Ausbildung. Doch müsse klar sein, dass dies auch für die Rolle als leitender Pfarrer im Gemeindegefüge zentral sei. Zudem müsse darüber gesprochen werden, wie Aufgaben vor Ort besser verteilt werden könnten, so der Fuldaer Bischof. Er kündigte an, dass sich die Arbeit an einer neuen Rahmenordnung für die Priesterausbildung kurz vor dem Abschluss befinde.