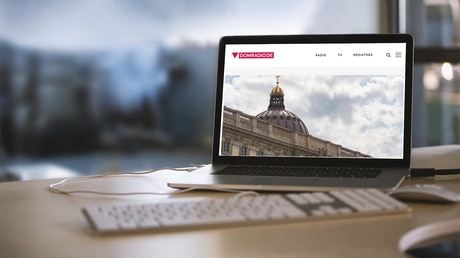Mit besonderer Aufmerksamkeit hat Papst Johannes Paul II. seit seinem Amtsantritt 1978 den Weg der bedrängten Kirchen in Mittel- und Osteuropa begleitet und gelenkt. Ein Musterbeispiel waren seine Polen-Reisen, mit denen er ab 1979 die Gewerkschaft "Solidarnosc" unterstützte, zugleich aber auch bremste, um unter dem Kriegsrecht eine Eskalation zu verhindern. Letztlich mit Erfolg: Nach den freien Wahlen in Polen kippten die kommunistischen Regime, die Berliner Mauer fiel, die Sowjetunion brach auseinander.
Aber die Kirche sollte nach Ansicht des Papstes nicht nur den Kampf um die Freiheit anführen. Danach sollte sie beim Neuaufbau Europas in vorderster Linie mit dabei sein und das geistige Vakuum von Kommunismus und Sozialismus durch christliche Werte auffüllen. Die Weichenstellung erwartete er von einer "Sondersynode für Europa", die er im April 1990 im tschechischen Wallfahrtsort Velehrad ankündigte. Dann dauerte es aber noch eineinhalb Jahre, bis die Versammlung schließlich vom 28. November bis zum 14. Dezember 1991 zusammentrat. Vielleicht etwas zu spät, wie Beobachter meinten. Denn die gesellschaftliche Vorreiterrolle, die die Kirche direkt vor und während der Wende innehatte, konnte sie danach nicht mehr in gleicher Form wahrnehmen.
Stunde der Märtyrerbischöfe
Dennoch war die Synode ein eindrucksvolles und bewegendes Treffen. "Das wichtigste Ereignis für die Kirche Europas seit dem Konzil", meinte der Mainzer Bischof Karl Lehmann, damals Sondersekretär der Synode. Zum ersten Mal seit 50 Jahren trafen sich katholische Bischöfe aus ganz Europa zu einer freien Aussprache.
Die Statuten ermöglichten eine zahlenmäßig stärkere Teilnahme aus Zentral- und Osteuropa . Es war die Stunde der Märtyrerbischöfe, die über Leben und Leiden ihrer Katakombenkirchen berichteten. Viele hatten einige Jahre in Haft verbracht, waren mit Berufsverboten belegt und mussten sich als Gelegenheitsarbeiter, als Fensterputzer oder am Bau durchschlagen.
Gegen Schwarz-Weiß-Malerei
Es war eine erste Bestandsaufnahme von Kirchen, die bislang wenig voneinander wussten, jetzt aber zusammenwachsen und -arbeiten mussten. Anfängliche Berührungsängste und Vorbehalte wurden keineswegs ganz aufgelöst. Aber die Synode trat mit einer nüchternen Auflistung von kirchlichen Vorzügen und Defiziten in Ost und West einer verbreiteten Schwarz-Weiß-Malerei entgegen. Selbstkritisch ließen östliche Kirchenführer erkennen, dass es mit der Glaubensstärke ihrer Kirchen oft nicht mehr so weit her war, seit der äußere Druck weg war. Umgekehrt hatten sich die angeblich "oberflächlichen" Kirchen des Westens durchaus in ihren freien Gesellschaften behauptet. "Die sind nicht so gut, und wir sind nicht so schlecht", meinte damals ein deutscher Synoden-Bischof.
Im Mittelpunkt stand die Frage, wie die Kirche nach dem Zusammenbruch der menschenverachtenden Ideologien geeint ihre Heilsbotschaft verkünden und ihren Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit, für Nächstenliebe, Solidarität und Menschenwürde leisten könne.
Streit um Ökumene
Für Sprengstoff und Zwietracht sorgte ausgerechnet das Thema, mit dem man Gemeinsamkeit schaffen wollte: die Ökumene. Erstmals waren nicht-katholische Christen nicht nur als Beobachter sondern als "Bruder-Delegierte" geladen - mit Rederecht. Aber die meisten orthodoxen Kirchen boykottierten das Treffen - aus Protest gegen römische Personalpolitik und angeblich aggressive katholische Missionsarbeit. In der Synodenaula fielen harte Worte, ein orthodoxer Sprecher drohte sogar mit Abbruch des theologischen Dialogs.
In der Tat hatten die politischen Veränderungen in Mittel- und Osteuropa neue Probleme mit der Orthodoxie geschaffen. Im Sog der Perestrojka stiegen die "Unierten" in der Ukraine aus dem Untergrund an die Öffentlichkeit und forderten Rechte und auch Kirchenbesitz zurück, die sie 1946 unter Stalin zwangsweise an das Moskauer Patriarchat abtreten mussten. Zudem waren die Russisch-Orthodoxen verstimmt über die Errichtung katholischer Organisationsstrukturen in ihrem Land.
Erst Euphorie, dann Umbruch
Acht Jahre später, im Oktober 1999 traten die Bischöfe Europas erneut zu einer Kontinentalsynode zusammen. Die Euphorie des Umbruchs war einer Ernüchterung gewichen - und einer neuen Sachlichkeit. Es ging differenziert um den Gebrauch der neuen Freiheit, im Osten wie im Westen. Gab es unmittelbar nach der Wende noch erhebliche Vorbehalte etwa gegen eine europäische Einigung, so fand sie jetzt mehr Befürworter.
Mit den beiden Sonder-Synoden verlor allerdings auch ein Gremium an Bedeutung, das zuvor maßgeblich die kirchliche Europa-Arbeit bestimmt hatte: der CCEE, der Rat der Europäischen Bischofskonferenzen. In den 1990er Jahren trat er aus dem Scheinwerferlicht. Europa ist seitdem vorrangig Sache des Vatikan.