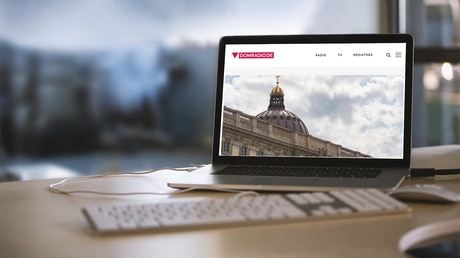KNA: Es gibt die These, die europäischen Mächte seien in den Ersten Weltkrieg quasi "hineingeschlittert". Gilt das auch für den Dreißigjährigen Krieg?
Georg Schmidt (Historiker an der Universität Jena): Dass sich die Krisen der Epoche wie eine Eieruhr damals zugespitzt und sich dann 1618 in diesen Krieg entladen hätten, sehe ich nicht. Die politische Krisensituation war 1610 deutlich größer. Der Krieg begann 1618 mit einem regionalen Konflikt, nämlich mit dem Kampf um die Freiheit der Nation und des evangelischen Glaubens in Böhmen.
KNA: Sehen Sie denn einen oder sogar mehrere Punkte, wo der Krieg hätte verhindert oder beendet werden können?
Schmidt: Kriege werden von Menschen gemacht – und wären also an jedem Punkt verhinderbar. Sie müssen nicht entstehen. Insofern ist natürlich jeder Krieg auch ein Politikversagen. Das gilt auch für den Dreißigjährigen Krieg. Nach der Bereinigung des Konflikts in Böhmen, als Ferdinand II. die Königskrone zurückgewonnen hatte, hätte der Krieg beendet werden können – wenn Ferdinand nicht die Hilfe des bayerischen Herzogs Maximilian benötigt und ihm Zusagen gemacht hätte.
KNA: Nämlich?
Schmidt: Er hat ihm den Gewinn der Oberpfalz und vor allen Dingen die pfälzische Kurwürde zugesagt. Beides gehörte Pfalzgraf Friedrich V., der sich 1619 von den Protestanten zum böhmischen König wählen ließ und diese Würde schon ein Jahr später mit der Schalcht am Weißen Berg wieder einbüßte. Maximilian eroberte danach die Oberpfalz und auch die Rheinpfalz. Da er auf militärischen Widerstand stieß, war der Krieg im Heiligen Römischen Reich angekommen.
KNA: Wie viel Religion beziehungsweise Konfession steckte überhaupt im Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges – und in seinem Verlauf?
Schmidt: Dieser Krieg wird häufig als Glaubenskrieg dargestellt. Das ist insofern richtig, als alle daran glaubten, dass Gott diesen Krieg wolle. Aus katholischer Perspektive, damit die evangelischen Ketzer vernichtet werden. Aus evangelischer, lutherischer Perspektive, damit das Papsttum und seine Helfer vernichtet werden. Das ist eine starke Motivation.
KNA: Aber?
Schmidt: Zwei feste konfessionelle Blöcke, die sich bekriegt hätten, gibt es in diesem Krieg nicht. Es gibt vor allem verschiedene politische Machtkämpfe. So greift etwa das katholische Frankreich, eine der beiden führenden Mächte Europas, auf der evangelischen Seite ein - gegen die katholischen Habsburger.
KNA: Der Westfälische Friedensschluss von 1648 wurde lange Zeit gar nicht als ein Sieg der Diplomatie gewertet. Warum?
Schmidt: Zunächst wurde er sehr wohl als Erfolg angesehen. Der Westfälische Frieden war ja im Prinzip ein Grundgesetz für das Heilige Römische Reich. Friedrich Schiller schrieb, dass dieser Frieden das «charaktervolleste Werk menschlichen Weisheit und Leidenschaft» gewesen sei. Das ist ein großes Lob. Und die Reichspublizistik, also Juristen, beschäftigten sich bis um 1800 intensiv mit diesem Frieden als der gültigen Reichsverfassung.
KNA: Wann kam der Bruch in der Wahrnehmung?
Schmidt: Im 19. Jahrhundert, als man versuchte, den deutschen Nationalstaat zu verwirklichen. Da wurde das alte Reich zum ungeliebten Gegenmodell. So sollte der Nationalstaat nicht sein:
strukturell nicht angriffsfähig; keine starke Zentralregierung. Die Idee war: Wir brauchen eine starken Nationalstaat in der Mitte Europas, damit keine Macht von außen uns zum Spielball ihrer Politik machen kann. Daraus wurde das Gegenmodell kreiert: der Westfälische Friede sei der Tiefpunkt gewesen; er habe die deutsche Souveränität verhindert und den fremden Garantiemächten erlaubt, Deutschland zum Spielfeld ihrer Politik zu machen. Da ist dann die Rede vom "Trauma des deutschen Volkes". In den Texten des 17. und 18. Jahrhunderts spürt man davon noch nichts.
KNA: Sehen Sie denn Parallelen zwischen dem Dreißigjährigen Krieg und heutigen Kriegen?
Schmidt: Mit dieser Analogiediskussion zielen viele auf eine Übertragbarkeit des Westfälischen Friedens, etwa auf die Kriege in Syrien oder auch am Horn von Afrika. Da bin ich eher skeptisch. Vergleiche über Jahrhunderte hinweg und in andere Kulturkreise hinein sorgen meist nur für Missverständnisse. So gehörten etwa Amnestie und immerwährendes Vergessen zur Basis des Westfälischen Friedens. Das könnte heute keiner aus der westlichen Welt mehr unterschreiben. Oder wollten Sie Assad im Biergarten als freien Mann neben sich sitzen haben?
KNA: Nun ja.
Schmidt: Das wäre aber ja eine Folge von Amnestie und immerwährendem Vergessen. Assad weiß natürlich heute: Wenn es irgendwie zum Frieden kommt, dann kann er sich eine Zelle in Den Haag mieten. Und das ist auch ein Friedenshindernis in Syrien. Von solchen Nicht-Analogien gibt es eine ganze Menge.
KNA: Zum Beispiel?
Schmidt: Im Westfälischen Frieden wird das Reich, wie es vor 1618 war, politisch leicht modifiziert wieder auf eine feste Basis gestellt. Auch das ist in Syrien schwer vorstellbar. Das war kein gescheiterter Staat, von dem man in Syrien wohl inzwischen sprechen kann. Oder der Vergleich zwischen Warlords heute und den Kriegsunternehmern damals. Auch das hinkt, weil die Kriegsunternehmer damals gar keine geschlossene Fläche militärisch kontrollierten. Während der Friedensverhandlungen damals gab es nicht eine einzige Vollversammlung - und damit auch keine Fensterreden und keinen massiven Druck der Öffentlichkeit wie heute. Das sind große Unterschiede, die man nicht unterschätzen darf.
KNA: Spielt der Dreißigjährige Krieg im kollektiven Gedächtnis anderer Nationen überhaupt eine Rolle - oder nur für die Deutschen?
Schmidt: Für die Deutschen, ein wenig auch für die Österreicher. Und auch in Tschechien spielt er eine gewisse Rolle. Aber die Tschechen feiern in diesem Jahr eher 100 Jahre Tschechoslowakische Republik und 50 Jahre Prager Frühling. In den anderen Ländern Europas, auch in Schweden, spielt der Dreißigjährige Krieg nur eine recht kleine Rolle. Für Schweden und auch für die Dänen ist das vor allem die Zeit großer Könige und auch eines gewissen imperialen Ausgreifens ihrer Reiche. Für Frankreich bedeutet dieser Krieg wenig, für England fast nichts. Da sind andere Kriege viel wichtiger.
Das Interview führte Alexander Brüggemann.