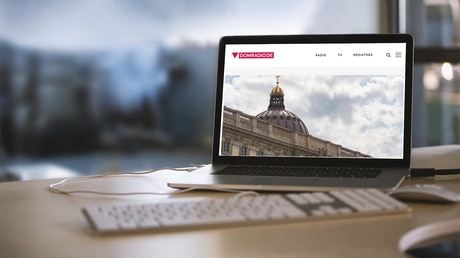domradio.de: Dass sich bei Partys schon seit längerem nicht mehr so viele Gäste auf dem Raucherbalkon drängeln, das haben die meisten von uns längst gemerkt... Weniger Tabakkonsum - ist das in Ihren Augen ein Grund zur Freude, oder doch eher nur ein Zeichen dafür, dass sich die Sucht verlagert?
Pfarrer Christian Ott (Suchtbeauftragter des Erzbistums Köln): Erst einmal ist es schön, dass weniger Leute rauchen, weil das natürlich gesünder ist. Wahrscheinlich kommt das daher, dass man sehr konsequent Tabakwerbung unterbunden hat, dass man den Rauchern das Rauchen erschwert hat, dass sie eben nicht mehr überall rauchen können. Das zeigt jetzt allmählich Wirkung. Wobei man schon genauer hinschauen muss, welche Altersgruppe das jeweils betrifft. Es gibt immer noch genügend Leute, die rauchen und dann auch an den Erkrankungen leiden, die das Rauchen mit sich bringt. Aber es gibt tatsächlich auch eine Verlagerung. Wir Suchtbeauftragte der deutschen Diözesen haben uns vor einigen Tagen in Augsburg getroffen und die süddeutschen Kollegen haben erzählt, dass synthetische Drogen wie Crystal Meth im Kommen sind; besonders in den Regionen, die an Tschechien grenzen, da kommt das verstärkt her. Die Kollegen sind sehr besorgt, weil das eine ganz andere Form von Sucht ist, die auch ganz andere körperliche und seelische Begleiterscheinungen mit sich bringt.
domradio.de: Mit welcher Sucht werden Sie bei Ihrer Arbeit am meisten konfrontiert?
Ott: Der Klassiker ist Alkohol. Meine Aufgabe bezieht sich ja zum größten Teil auf den pastoralen Dienst, also auf Menschen aus den Berufen der Kleriker - Priester und Diakone, aber auch Pastoral- und Gemeindereferenten und alle, die sich im weiteren Kontext des kirchlichen Dienstes bewegen. Da ist die Suchterkrankung Nummer eins der Alkohol; zwar zahlenmäßig nicht in dem Maß, wie wir es in der Gesellschaft vorfinden. Vermutlich gibt es aber denselben Trend, aber es kommt eben nicht alles bei uns an. Am schönsten ist es, wenn die Betroffenen von sich aus zu uns kommen, uns ansprechen und uns fragen, ob wir helfen können.
domradio.de: Aber den meisten ist ihre Sucht ja peinlich....
Ott: Das Problem bei der Sucht ist, und das ist dann bereits Teil der Sucht, dass Menschen denken, sie hätten alles im Griff. Aber in Wirklichkeit regulieren sie mit dem Konsum eines Suchtmittels schon ihren Stresspegel. Sie denken aber weiter: „Da ich es ja im Griff habe, könnte ich jederzeit aufhören.“ Tatsächlich ist dem nicht so. Sich das einzugestehen ist schon ein enormer Schritt, weil er bedeutet „ich bin gegenüber diesem Suchtmittel hilflos.“ Da ist es natürlich gut, wenn ein Mensch selbst an diesen Punkt kommt; aber das dauert. In der Regel sind es erst einmal andere, die etwas bemerken und manchmal melden sich dann diese Anderen. Aber die Anderen haben nicht unbedingt den Mut, die Dinge beim Namen zu nennen.
domradio.de: Natürlich ist jeder Fall individuell - aber was hilft den Betroffenen aus Ihrer Erfahrung heraus am meisten? Helfen da beispielsweise auch Gebete?
Ott: Wenn ein Mensch religiös ist, ist es auch wichtig, mit ihm zu beten, weil das Beten dann ja zu seinem inneren Wertekosmos dazugehört. Es ist schön, wenn man das teilen kann. Das ist allerdings nicht die erste Priorität. Man wird nicht durchs Beten gesund, sondern das Beten hilft, das zu unterstützen, was man sich als seinen Gesundungsweg vornimmt. Wir müssen das noch mal ganz klar sagen: Sucht ist eine Erkrankung und kein Charakterfehler. Die Betroffenen sind nicht etwa Menschen mit schwachem Willen, sondern sie sind krank. Und ein Mensch, der krank ist, braucht verschiedenerlei Beistand. Der braucht eine gute Medizin, der braucht einen guten Arzt und er braucht natürlich auch Menschen, die seine Abwehrkräfte mit stärken helfen. Und da gehört dann das gemeinsame Beten mit dazu, wenn es gefragt ist.
domradio.de: Was würden Sie sich wünschen - was könnte die katholische Kirche anders machen, um Menschen mit Suchtproblematik besser zu helfen?
Ott: Ich glaube, wir müssen viel offener darüber sprechen. Deswegen bin ich dankbar für dieses Gespräch. Wir müssen die Dinge beim Namen nennen! Einer der Referenten bei unserer Suchtfachtagung vergangene Woche hat gesagt: „Wenn man das Unsagbare nicht ausspricht, wird das Leben unsäglich.“ Das trifft für Sucht in besonderer Weise zu. Dass nämlich alle versuchen, darum herum zu reden, dass es da einen Kontrollverlust gibt. Erst wenn der benannt und eingesehen wird, kann sich etwas verändern. Erst dann finden die Betroffenen die Kraft, sich tatsächlich helfen zu lassen.
Das Gespräch führte Milena Furman.