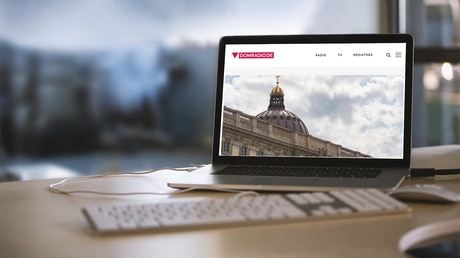DOMRADIO.DE: Die Corona-Pandemie hat mit Sicherheit in irgendeiner Weise Auswirkungen auf die Krisenherde und Konflikte in der Welt gehabt, oder?
Prof. Tobias Debiel (Institut für Entwicklung und Frieden (INEF) an der Uni Duisburg-Essen und Mitherausgeber des Friedensgutachtens): Genau. Die Lage in der Welt ist nach wie vor sehr schlecht. Ähnlich wie zur Zeit des Kalten Krieges. Wir haben 128 Gewaltkonflikte gezählt. Das ist fast ein Rekord.
Die Coronalage lässt sich zwar noch nicht unmittelbar in den Konfliktzahlen nachweisen, aber wir haben Hinweise dafür, dass sich die Lage insbesondere im humanitären Bereich verschärft. Die Flüchtlingshilfsorganisation UNHCR hat darauf hingewiesen, dass wir 80 Millionen Flüchtlinge haben.
Dann gibt es eine zweite Tendenz: Sicherheitskräfte ziehen sich zurück. Wir haben das in einer Studie für Mosambik auch nachweisen können. Dschihadistische Gruppen sind im Vormarsch.
Und wir haben natürlich ein grundlegendes Problem, denn die Friedensoperationen sind gelähmt und die Krisendiplomatie kocht auf Sparflamme. Von daher ist zum Beispiel die Initiative des UN-Generalsekretärs für einen globalen Waffenstillstand bislang kaum umgesetzt worden.
DOMRADIO.DE: Was sind denn die Herausforderungen für die Friedenslösung und Krisendiplomatie zurzeit?
Debiel: Es gibt letztlich zwei große Herausforderungen. Die erste für die Krisendiplomatie sind die Konflikte in Libyen und in Syrien. Das zweite ist, dass die Entwicklungszusammenarbeit auch präventiv tätig werden muss.
Bei der Krisendiplomatie würde ich gerne darauf verweisen, dass sich Deutschland in den vergangenen Jahren recht zurückgehalten hat, dann aber im Januar 2020 eine Initiative zur Beilegung des Libyen-Konfliktes in Gang gesetzt hat. Da hat man gesehen, was Deutschland leisten kann, wenn es sich tatsächlich ins Zeug legt. Der Libyen-Konflikt ist aber unterdessen wieder eskaliert. Wir hatten erhebliche Kämpfe in Tripolis. Das Land droht ein zweites Somalia zu werden. Hier wäre ein Wiederaufnehmen der Initiative notwendig.
Bei Syrien geht es darum, tatsächlich Druck auf Russland und auch auf die Türkei auszuüben. Da ist die Lage aus meiner Sicht mindestens genauso verzweifelt.
DOMRADIO.DE: Wir erleben soziale Bewegungen und Proteste, die zum einen unmittelbar mit den Corona-Beschränkungen zu tun haben. Dann gibt es andererseits aber neue Proteste wie beispielsweise Antirassismus-Bewegungen und zudem die bestehenden Konflikte, die vor dem Pandemieausbruch schwelten. Die sind ja nicht einfach aufgelöst. Wie wird es weitergehen, wenn wir in einer neuen Normalität leben?
Debiel: Es gab tatsächlich im Jahr 2019 ein Hoch von Massenprotest-Bewegungen. Wir haben alleine 65 Protestbewegungen mit über 50.000 Beteiligten gezählt. Das ist ein erneut ein Rekord.
Das Interessante bei den Bewegungen ist, dass sie sich nicht allein auf Autokratien, also auf diktatorische Regime, beziehen, sondern auch in etablierten Demokratien wie beispielsweise in Chile stattfinden.
Wir haben dann mit der Corona-Pandemie erst einmal einen Einbruch bei den Zahlen verzeichnet. Etwa 50 Länder sind unter Notstandsgesetzgebung. Insgesamt sind auch die Demokratiewerte gefallen. Das hat sehr negative Auswirkungen in vielen Ländern.
Jetzt hat sich die Lage wieder etwas verändert. Es gibt dort ein Tracker - also eine Datenbank, die das verfolgt. Wir haben zurzeit gerade Proteste, wenn es darum geht, dass Löhne nicht gezahlt werden und dass die Regierungen sich nicht genügend bei der Coronavirus-Bekämpfung engagieren. Das können wir insbesondere in Lateinamerika, aber auch in Südostasien beobachten.
DOMRADIO.DE: Auch die Klimakrise ist immer wieder Gegenstand von globalen Diskussionen und bietet Konfliktpotenzial. Wie werden die Konflikte rund ums Klima weitergehen?
Debiel: Wir können - das ist vielleicht interessant - bislang noch keine ganz unmittelbaren Rückwirkungen auf Gewaltkonflikte feststellen. Aber es stehen zwei Dinge zu befürchten. Einmal, dass lokale Konflikte zwischen Pastoralisten, also den Menschen, die von Viehherden leben, und sesshaften Bauern zunehmen.
Das zweite Problem ist, dass wir mit Fluchtbewegungen in einer Größenordnung von bis zu 50 Millionen Flüchtlinge rechen. Und das erzeugt Druck. Die Bundesregierung kann einiges tun, weil sie im UN-Sicherheitsrat sich befindet. In den Vereinten Nationen kann man insbesondere den Krisendialog mit Konfliktregionen entsprechend in Gang setzen.
Wir setzen aber vor allem auf Frühwarnmechanismen. Und da gibt es gerade auf regionaler Ebene Ansätze, dass man die Rückwirkungen auch messen kann. Da muss die Bundesregierung nachlegen, weil die Frühwarnanalysen bislang auf die Ministerien verteilt sind.
DOMRADIO.DE: Viele wünschen sich Weltfrieden, nicht nur scherzhaft zum Geburtstag. Was muss denn passieren, damit wir endlich Frieden bekommen?
Debiel: Es gibt zwei zentrale Entwicklungen, die notwendig sind. Einmal müssen die Vereinten Nationen wieder gestärkt werden. Sie haben einen erheblichen Bedeutungsverlust erfahren.
Und das andere ist: Auch die Großmächte müssen zusammenfinden. Russland hat sich aus der multilateralen Zusammenarbeit weitgehend verabschiedet. Die USA ziehen sich auch zurück. China kocht sein eigenes Süppchen. Wir plädieren dafür, dass die EU diese Großmächte wieder in den Dialog bringt.