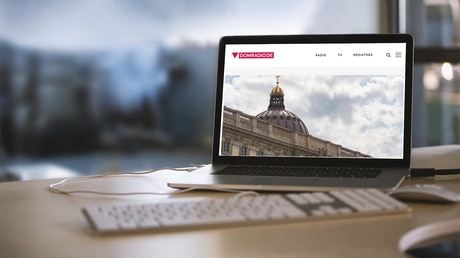Eines kann man Donald Trump sicher nicht vorwerfen: Dass der US-Präsident die Konfrontation scheut. Am Freitag (Ortszeit) trat er vor die Presse, um zu verkünden, dass er den nationalen Notstand ausgerufen habe. Damit will er am Kongress vorbei an zusätzliches Geld für den Ausbau der Grenzanlagen zwischen Mexiko und den USA kommen.
Der Schritt ist umstritten. Mehrere Bundesstaaten kündigten bereits an, rechtlich dagegen vorzugehen. Für sein zentrales Wahlversprechen, die Errichtung einer möglichst durchgehenden "Mauer", kalkuliert Trump mit 5,7 Milliarden US-Dollar - der Kongress wollte dagegen lediglich 1,375 Milliarden bewilligen.
Trump malt ein Schreckgespenst
Zu wenig für den Präsidenten, der erneut das Schreckgespenst einer "nationalen Sicherheitskrise" heraufbeschwor und hinzufügte: "Wir reden über eine Invasion unseres Landes mit Drogen, Menschenhändlern, allen Arten von Kriminellen und Gangs." Eine pauschale Herabwürdigung von Menschen gehört zu Trumps Rhetorik. Zugleich versucht der Präsident den Eindruck zu erwecken, als würden die Migranten, gegen die sich der Mauerbau richtet, Gewalt und soziale Konflikte aus Süd- und Mittelamerika über die Grenze exportieren. Probleme, mit denen die Vereinigten Staaten nichts zu tun hätten.
Blick nach El Salvador
Doch dem ist nicht so. Im Gegenteil: Gerade die gesellschaftlichen Verwerfungen in Mittelamerika sind zumindest zu Teilen ein Ergebnis der US-Politik. Deutlich wird das zum Beispiel rund 3.000 Kilometer Luftlinie südlich von Washington, in El Salvador. "Die USA haben Zentralamerika immer als ihren Hinterhof betrachtet, der keine eigene Würde hat, sondern ihren Interessen zu dienen hat", sagt die aus Österreich stammende Theologin Martha Zechmeister, die an der von Jesuiten gegründeten Universidad Centroamericana (UCA) in San Salvador lehrt.
Zwischen 1980 und 1991 erschütterte ein blutiger Bürgerkrieg zwischen der Militärjunta und der linksgerichteten FMLN das kleinste Land Mittelamerikas. Die USA hätten sich in diesem Konflikt auf die Seite der Militärs geschlagen und Unsummen in einen "Krieg gegen die Kommunisten" investiert, sagt Zechmeister. Auf dem Rücken der Bevölkerung sei damals die Konfrontation zwischen den Supermächten ausgetragen worden.
Rund 70.000 Menschen starben, viele Salvadorianer verließen ihr Land - nicht wenige davon gingen in die USA, wo sich bereits zahlreiche Landsleute niedergelassen hatten, um Armut und Perspektivlosigkeit zu entfliehen. Doch in ihrer neuen Heimat waren die Neuankömmlinge selten wohlgelitten. "Sie haben dort in sehr großer Armut gelebt, sich auch mit Rassismus auseinandersetzen müssen", sagt Benjamin Schwab, der wie Zechmeister an der Uni in San Salvador forscht.
Vor allem die Jugendlichen gerieten dort bald auf die schiefe Bahn - und schlossen sich zu Gangs zusammen, Vorläufer der berüchtigten Mara-Banden, die heute in El Salvador, aber auch in den Nachbarstaaten Guatemala und Honduras für Angst und Schrecken sorgen.
Bischöfe melden sich zu Wort
Die Probleme, von denen Trump spricht, fußen also zu einem nicht unerheblichen Maß in den USA - und gelangten von dort zurück nach Mittelamerika, als die US-Behörden Anfang der 1990er-Jahre begannen, kriminell gewordene Jugendliche aus El Salvador und anderen Staaten, die teilweise gar keinen Bezug mehr zu ihren Herkunftsländern hatten, in großer Zahl abzuschieben. "In Wirklichkeit müssten nicht die USA vor Zentralamerika, sondern Zentralamerika vor den USA geschützt werden", fasst Zechmeister zusammen.
Prominente wie Kardinal Gregorio Rosa Chavez werben dafür, mit vereinten Kräften die Gesellschaften in der Krisenregion zu stabilisieren. Der Weihbischof von San Salvador, der als einer der einflussreichsten Kirchenmänner in der Region gilt, macht sich für einen "Wandel von der Wurzel her" stark. Auf Trump und dessen Mauer geht Rosa Chavez nicht ein.
Dafür meldeten sich am Wochenende die katholischen Bischöfe in den USA zu Wort. Das Projekt sei "in erster Linie ein Symbol für Spaltung und Feindseligkeit zwischen zwei befreundeten Ländern". Dann fügten sie hinzu: Auch Papst Franziskus habe betont, dass es in der Welt Brücken anstatt Mauern brauche.