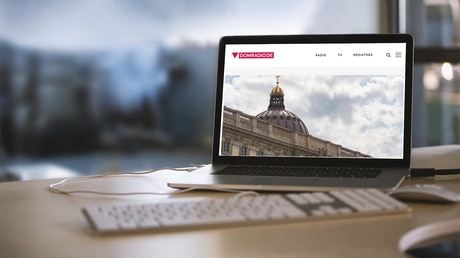KNA: Herr Grebe, in den vergangenen Monaten wurden zahlreiche umstrittene Waffengeschäft bekannt. Liegt das an einer wachsenden Transparenz oder steigt die Zahl der Waffendeals?
Jan Grebe: Die Transparenz im Waffenhandel ist mit Sicherheit nicht gewachsen. Solche Geschäfte finden unter strenger Geheimhaltung statt. Stattdessen gibt es von Seiten der Industrie verstärkt Rufe nach mehr Waffenexporten - mit der Begründung, dass die Inlandsnachfrage im Zuge der Bundeswehrreform gesunken sei. Damit setzt die Rüstungslobby die Bundesregierung stark unter Druck.
KNA: Welche Bedeutung hat die Rüstungsindustrie für die Wirtschaft?
Grebe: Es ist schwierig, verlässliche Aussagen über die tatsächlichen Arbeitsplätze und die Umsätze zu machen. Es wird vermutet, dass etwa 80.000 Menschen in der Rüstungsindustrie beschäftigt sind. Die gesamten Rüstungsexporte machen etwa 0,5 Prozent des gesamten Außenhandels aus, Kriegswaffenexporte gar nur etwa 0,2 Prozent. Befürworter hingegen verweisen stets auf die sicherheitspolitische Bedeutung einer gut aufgestellten Rüstungsindustrie und sehen Arbeitsplätze in Gefahr. Unabhängig vom Druck der Rüstungslobby gibt es außerdem Anzeichen für eine grundsätzliche Veränderung der Außen- und Sicherheitspolitik.
KNA: Was verändert sich?
Grebe: Es scheint, als setze die Bundesregierung verstärkt darauf, halbwegs stabile Staaten in Krisenregionen mit Waffen auszurüsten, in der Hoffnung, dass sie zur Stabilität in der Region beitragen. Möglicherweise soll damit auch verhindert werden, dass Deutschland selbst sich mit der Bundeswehr an Militäreinsätzen beteiligen muss.
KNA: Wie bewerten Sie diese Strategie?
Grebe: Ich halte das für hochriskant. Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass man mit Aufrüstung Stabilität schaffen kann. Gerade die Staaten in der arabischen Welt sind stark militarisiert und verfügen über ein hohes militärisches Potenzial. Durch Waffengeschäfte kann der dortige Rüstungswettkampf verstärkt werden und schlimmstenfalls eskalieren.
KNA: Sehen Sie darin auch eine Gefahr für Deutschland?
Grebe: Natürlich. Ein Panzer ist ein langlebiges Rüstungsgut und hält mindestens 10, 15, 20 Jahre. Und es ist völlig ungewiss, was dann mit den Panzern passiert. Es gibt die theoretische Gefahr, dass es in den Ländern, die wir jetzt mit Waffen beliefern, zu einem Umbruch kommt und unsere Panzer dann auch noch in andere Hände geraten. Die Bundesregierung hat letztlich überhaupt keine Kontrolle über den Einsatz der Waffen.
KNA: Wie lassen sich derartige Waffengeschäfte mit der Verpflichtung Deutschlands zur Achtung der Menschenrechte vereinbaren?
Grebe: Vor dem Hintergrund der Menschenrechtslage in den betreffenden Staaten sind die Exporte fragwürdig. In den Leitlinien der Bundesrepublik und der Europäischen Union ist festgeschrieben, dass keine Waffen in Krisen- und Konfliktgebiete geliefert werden dürfen. Diese Richtlinien haben allerdings offenbar nicht mehr die Bedeutung, die sie in der Vergangenheit hatten. Auch das ist ein Anzeichen für Veränderungen in der Politik, die darauf abzielen, den Export zu begünstigen.
KNA: Wird es solche Richtlinien in Zukunft überhaupt noch geben? Welche Entwicklung erwarten Sie?
Grebe: Wichtig wäre, dass die auf europäischer Ebene geschaffenen Regelungen restriktiver und verbindlicher gestaltet werden und dass sich alle EU-Staaten an diese halten. Noch immer ist die fehlende Transparenz im Waffenhandel eines der größten Probleme. Die Bundesrepublik berichtet viel zu spät über ihre Geschäfte und gibt kaum Informationen preis. Das Parlament und die Öffentlichkeit werden zu wenig informiert. Das muss sich ändern, die Regierung muss den Schleier des Geheimnisvollen lüften, dann könnte man solche Geschäfte auch besser bewerten. Das geht nicht ohne verlässliche Informationen - wir wissen bis heute nicht, ob das umstrittene Geschäft mit Saudi Arabien vom vergangenen Jahr genehmigt wurde.
Das Interview führte Inga Kilian.
Hintergrund
Laut "Spiegel" sollen 200 Leopard-II-Panzer nach Katar exportiert werden, zum Preis von rund zwei Milliarden Euro. Der stellvertretende Regierungssprecher Georg Streiter sagte dazu lediglich, die Regierung wisse, dass Katar Interesse bekundet habe. Zudem will die Bundesregierung laut "Financial Times Deutschland" die strengen Regeln für Waffenexporte aufweichen und in der NATO angleichen. Nutznießer wären demnach unter anderem die sechs autoritär regierten Staaten des Golfkooperationsrats, darunter Saudi-Arabien und Katar. Auch Saudi-Arabien hat Interesse am Kauf von mindestens 270 deutschen Panzern.
Dazu sagte der Bamberger Erzbischof Schick gegenüber domradio.de, dass Deutschland auch an Länder, in denen Kriegsgefahr herrscht und in denen Menschen in Bürgerkriegen unterdrückt werden, Waffen geliefert würden. Auch in Katar sei es nicht sicher, ob deutsche Waffen nicht gegen Menschen eingesetzt würden anstatt nur zur Verteidigung der eigenen Nation. Es müsse verhindert werden, dass deutsche Waffen missbraucht und zu Tötungswaffens werden. Gleichzeitig bedaurte Schick das Scheitern der Verhandlungen auf UN-Ebene zur Reglementierung internationaler Waffenlieferungen.
Gertrud Casel von Justitia et Pax sprach von einer krassen Verletzung der deutschen Rüstungsexportkriterien. Waffenlieferungen an Katar oder Saudi-Arabien würden das Wettrüsten in einer Krisenregion verschärfen, kritisierte Casel am Dienstag gegenüber domradio.de. Zudem sei Katar keine Demokratie, Menschenrechtsverletzungen seien an der Tagesordnung. Falls der Export zustande käme, wäre das ein weiterer Schritt einer fatalen Entwicklung der deutschen Exportpolitik.
Der Sprecher des Bundesausschusses Friedensratschlag, Peter Strutynski, sagte: "Es gibt weder ein Parlament, noch sind politische Parteien oder Gewerkschaften zugelassen." In Katar herrsche die islamische Rechtsordnung Scharia, und die Menschenrechtssituation werde von Amnesty International als besonders problematisch eingestuft.
Strutynski wies darauf hin, dass die Mehrheit der deutschen Bevölkerung Rüstungsexporte in solche Staaten ablehne. Im Namen der Friedensbewegung forderte er eine Initiative zum Stopp des Exportgeschäfts. Auch müsse der geheim tagende Bundessicherheitsrat aufgelöst werden, der parlamentarisch nicht kontrollierbar sei. Der Rat entscheidet über die Zulässigkeit von Rüstungsexporten.Strutynski kündigte am diesjährigen Antikriegstag Protestaktionen an einigen Standorten von Krauss-Maffei Wegmann an, etwa am 31. August in Kassel.
Die Linke rügte, der Export käme einer "Seligsprechung von Diktatoren und Folterern gleich" und warnte vor weiteren Waffenexporten in die arabische Welt. "Das freie Fluten deutscher Waffen in die Golfregion muss endlich aufhören", sagte der stellvertretende Parteivorsitzende und außenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Jan van Aken. "Dies wäre die endgültige moralische Bankrotterklärung Angela Merkels." Längerfristig seien solche Exporte hochgefährlich, denn Regimes änderten sich, die Waffen aber blieben. So produziere der Iran heute noch G3-Sturmgewehre in einer Fabrik, die einst dem Schah geschenkt worden sei. Und die Taliban in Afghanistan kämpften mit Waffen, die einst für den Kampf gegen die Sowjetunion geliefert wurden.
Das Auslandsgeschäft mit Panzern, Waffen, Flugzeugen und anderen Rüstungsgütern ist umstritten, aber zugleich ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Laut dem jüngsten Rüstungsexportbericht der Bundesregierung wurden 2010 Ausfuhrgenehmigungen für militärische Güter im Wert von 4,7 Milliarden Euro erteilt.
Die SPD monierte, die politischen Richtlinien verböten die Lieferung von Kriegswaffen in Spannungsgebiete. Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Gernot Erler, sagte: "Dasselbe, was gegen Leopard-Panzer für Saudi-Arabien einzuwenden ist, gilt für Katar: Die politischen Richtlinien verbieten die Lieferung von Kriegswaffen in Spannungsgebiete. Ein besonderes deutsches Sicherheitsinteresse lässt sich bei beiden Empfängerländern nicht erkennen." Die Bundesregierung müsse dem Bundestag unverzüglich darlegen, welche Rolle sie eigentlich im Nahost-Friedensprozess spielen wolle und welche Funktion dabei die umfangreichen Panzerlieferungen einnehmen sollen."