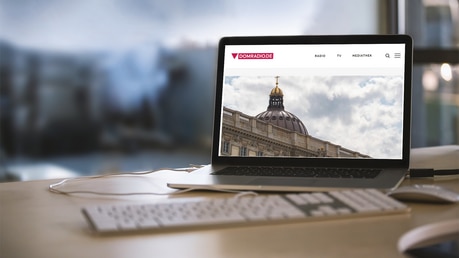Frage: Sie führen schon jetzt als Arzt mit eigener Praxis, als Präsident der bayerischen Juden und als Vizepräsident der Juden in Deutschland ein Leben mit übervollem Terminkalender. Warum haben Sie sich dennoch für die Kandidatur entschieden?
Antwort: Ich habe in den letzten vier Jahren eng mit dem jetzigen Präsidenten zusammengearbeitet. Ich denke gemeinsam, natürlich unter seiner Führung, ist es gelungen, den Zentralrat in seiner personellen Struktur umzubauen. Und nachdem Herr Graumann und ich sehr ähnliche Gedankengänge haben - auch was die Situation jüdischer Gemeinden in Deutschland und die Zukunftsperspektiven jüdischer Gemeinden in Deutschland angeht, ist es mir wichtig, die Arbeit, die Herr Graumann so erfolgreich begonnen hat, fortzusetzen. Das ist für mich eine logische Konsequenz.
Frage: Was sind Ihrer Meinung nach Dieter Graumanns Verdienste?
Antwort: Ich denke, Dieter Graumann hat dem Zentralrat ein Fundament geliefert. Damit meine ich die finanzielle Ausstattung mit der Verdopplung der finanziellen Hilfen durch den Staatsvertrag. Er hat den Zentralrat personell anders aufgestellt. Daneben hat er ganz stark daran gearbeitet, die Perspektive darauf zu lenken, dass Judentum nicht nur Trauer und Gedenken an den Holocaust bedeutet, sondern jüdische Gemeinden zukunftsgewandt, fröhlich und stark kulturell geprägt sind. Das ist noch nicht überall in der Gesellschaft angekommen. Das liegt aber nicht an Herrn Graumann, sondern an den gesellschaftlichen Einstellungen. Ich möchte diesen Ansatz von Dieter Graumann weiterführen.
Frage: Wie wollen Sie in Ihrer Amtszeit mit den gegensätzlichen Ansichten der liberalen und orthodoxen Juden umgehen?
Antwort: Unter dem Dach des Zentralrats gibt es zwei Rabbinerkonferenzen - sowohl traditionell wie liberal, die mir beide sehr wichtig sind. Es sind für mich keine Gegensätze. Das traditionelle und das liberale Judentum sind in der Ausübung der Religion nicht einheitlich, aber sie sind keine Gegensätze. Die Frage ist jetzt, sitzen Männer und Frauen zusammen oder nicht? Werden Frauen zur Thora-Lesung aufgerufen oder nicht? Werden Frauen als Rabbinerinnen denkbar oder nicht? Das ist aber für mich kein konträrer Gegensatz, sondern nur ein anderer Weg in die gleiche Richtung.
Frage: Wofür wollen Sie in Ihrer Amtszeit stehen?
Antwort: Die Offenheit und die Pluralität des Judentums weiter zu unterstützen, ist mir ausgesprochen wichtig. Das Idealbild einer jüdischen Gemeinde ist für mich die Gemeinde in Frankfurt, wo unter ein und dem selben Dach sowohl ein traditioneller Gottesdienst stattfindet und eine Etage tiefer ein liberaler Gottesdienst mit einer Rabbinerin. Das für mich immer noch Überraschende ist: das Dach hält.
Frage: Graumann wollte die aus Osteuropa zugewanderten Juden noch besser integrieren. Ist das gelungen oder bleibt diese Aufgabe weiterhin aktuell?
Antwort: Die Integration der Zuwanderer aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion, die ja vor allem in den 90er Jahren und bis etwa 2005/2006 gekommen sind, hat in den meisten Gemeinden sehr gut geklappt. Dazu ist meine unveränderte Meinung: Das war für uns ein Segen.
Hätten wir die Zuwanderer nicht, gäbe es heute nicht über 100 jüdische Gemeinden in Deutschland, sondern deutlich weniger. Wenn wir vor der Zuwanderung 30 000 Mitglieder hatten und heute 108 000, möchte ich behaupten, dass wir heute anderenfalls nur 15 000 jüdische Menschen hätten, die in Deutschland leben. Das war ein Segen für die jüdischen Gemeinden - ohne Wenn und Aber.
Frage: Aber es bleibt eine Herausforderung?
Antwort: Natürlich ist es auch eine Herausforderung, wenn eine Minorität eine Majorität integrieren will. Eine Majorität, die verständlicherweise von ihrer Religion, vom Judentum sehr weit entfernt war - das war nicht das Thema Nummer eins in den Staaten der Sowjetunion. Und dann ist es eine Herausforderung, wenn man denen vermitteln will, was Judentum und was jüdische Religion ist. Ich denke aber, dass das in den allermeisten Gemeinden gut gelungen ist.
Schwieriger hat es sich in den neuen Bundesländern dargestellt. Dort waren die Zuwanderer in einigen Orten unter sich. Das ist nicht schlecht. Aber wenn nur Menschen unter sich sind, die von Religion wenig Ahnung haben, dann ist es eher schwer, sie der Religion näher zu bringen und ihnen klar zu machen, dass es sich um eine Kultusgemeinde und keine Kulturgemeinde handelt. Aber das ist ein Thema, das nicht nur auf die neuen Bundesländer beschränkt ist. Die Herausforderung bleibt also.