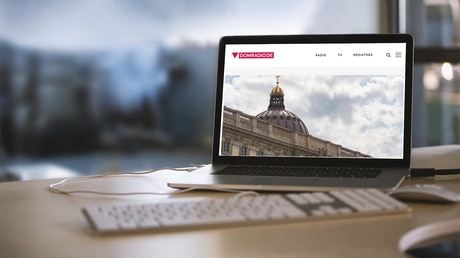Eine breit verankerte Bewegung ist daraus allerdings nicht geworden: Schon Bundespräsident Theodor Heuss sagte in einer Rundfunkrede zur Eröffnung der ersten Aktion 1952, wer es wage, sieben Jahre nach dem Ende des Holocaust einen christlich-jüdischen Dialog einzuleiten, "mag manchem als ein Träumer erscheinen". Wahre Worte auch angesichts der Tatsache, dass zwischen 1945 und 1950 von 500 jüdischen Friedhöfen fast 200 geschändet wurden.
Für die Amerikaner war die Gründung christlich-jüdischer Gesellschaften Teil des Umerziehungskonzepts in Deutschland. Viele Deutsche wiederum empfanden das Vorgehen der Besatzungsmacht zunächst als aufgezwungen und machten nur widerstrebend mit, wie Salomon Korn, Vorstandsmitglied der Frankfurter Jüdischen Gemeinde, zurückblickend beklagte.
Sache einer Minderheit
Der christlich-jüdische Dialog blieb Sache einer Minderheit. An führender Stelle etwa der Rektor der Uni Frankfurt und CDU-Politiker Franz Böhm, der Anfang der 50er Jahre die deutsche Delegation für die Wiedergutmachungsverhandlungen mit Israel leitete. Der Gründungsvorsitzende der Frankfurter Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit protestierte heftig gegen den alten und neuen Nazismus und forderte, "dem Antisemitismus und dem inhumanen Vorurteil eine entschlossene, aktive, einflussreiche und wirksam eingreifende Gegenbewegung entgegenzustellen".
Bis 1952 kümmerten sich Staat und Parteien nicht um die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Dann plötzlich erhielten sie staatliche Förderung, weil die Anwesenheit von Juden das Ansehen der Bundesrepublik international steigern und die Aussöhnungspolitik von Bundeskanzler Adenauer gegenüber Israel stützen konnte.
Auch die "Woche der Brüderlichkeit", nach US-Vorbild ins Leben gerufen, stand in der Gefahr der Instrumentalisierung, wie der frühere Generalsekretär des Koordinierungsrates, Josef Foschepoth, analysierte. Kritiker warnten vor Heuchelei und einem Zudecken der Vergangenheit. Die Aktion dürfe nicht zu einer "Propagandawaffe" im Kalten Krieg werden, sagte etwa die Geschäftsführerin der Freiburger Gesellschaft, Gertrud Luckner.
Verlagerung der Probleme
Sich mit der Frage von deutscher Schuld und Verantwortung zu befassen, wurde erst in den 60er Jahren, auch unter dem Eindruck der Auschwitzprozesse und der Studentenbewegung, selbstverständlicher. Ausdruck dieser Entwicklung ist auch die Buber-Rosenzweig-Medaille, die seit 1968 jährlich während der Woche verliehen wird und diesmal an den Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Nikolaus Schneider (64), geht.
Seitdem haben sich die Probleme verlagert. Kritiker warnten vor einer "Ritualisierung" des Gedenkens. Für Rudolf W. Sirsch, Generalsekretär des Koordinierungsrates der derzeit 83 Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit, eine unberechtigte Sorge. Die "Woche der Brüderlichkeit" halte zwar auch die Erinnerung an den Holocaust wach, sagte er. Zugleich richte sich der Blick aber in die Zukunft. Sirsch verwies auf das im Rahmen der Woche jährlich stattfindende Treffen von Vertretern der christlichen Kirchen und der Rabbinerkonferenzen. Dabei gehe es diesmal um Umwelt- und Tierschutz, im vergangenen Jahr war die Stammzellforschung Thema. Die Aufdeckung des neonazistischen Terrrors habe zudem gezeigt, dass die Bekämpfung von Antisemitismus und Rassismus ein bleibendes Thema sei.
60 Jahre "Woche der Brüderlichkeit"
Dialog mit Hindernissen
Vor 60 Jahren, sieben Jahre nach dem Ende des Holocausts, fand in der Bundesrepublik die erste bundesweite "Woche der Brüderlichkeit" statt. Ziel der Aktion, die seitdem jährlich von den Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit getragen und diesmal am Sonntag in Leipzig eröffnet wird: die religiöse Tradition der Juden, ihre Geschichte und Verfolgung im öffentlichen Bewusstsein zu halten, den Dialog zwischen Christen und Juden zu fördern und Stellung zu beziehen.

Share on