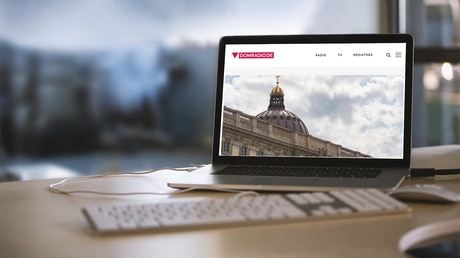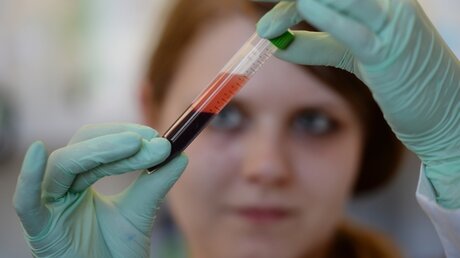DOMRADIO.DE: Heute am Welt-Down-Syndrom-Tag stellt sich die Frage besonders: Werden Menschen mit Behinderung ausgegrenzt? Wie erleben Sie das?
Dr. Werner Kleine (Pastoralreferent für Citypastoral im Stadtdekanat in Wuppertal): Ich kann das nicht bestätigen. Ich bin Vater von zwei Kindern mit Down-Syndrom. Meine Tochter ist mittlerweile 20, unser Sohn ist 24 Jahre alt. Wir haben in dieser Zeit, wo die Kinder bei uns sind, eigentlich sehr wenige negative Erfahrungen gemacht. Die kann man noch nicht mal von einer Hand abzählen.
Ich muss dabei sagen, beide Kinder wurden von mir und meiner Frau adoptiert. Es sind also nicht unsere leiblichen Kinder. Wir haben bei beiden Kindern gewusst, dass sie behindert sind. Was bei unserer Tochter ein zusätzlicher Segen war, weil wir vor der Adoption wussten, dass sie einen Herzfehler hat, der operativ korrigiert werden kann und muss. Bevor wir damals nach Rosenheim gefahren sind, um sie abzuholen, sind wir in St. Augustin im Kinderherzzentrum gewesen. Wir konnten uns da sehr gut informieren und wussten, was auf uns zukommt.
DOMRADIO.DE: Die Caritas fordert, dass für die Pränataldiagnostik keine Kassenzahlungen geleistet werden sollen. Fängt für Sie da schon Ausgrenzung an?
Kleine: Sie ist an sich ja nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Man könnte ja durch die Pränataldiagnostik herausbekommen, da ist mit diesem Kind etwas Besonderes – wir bereiten uns jetzt auf den Empfang dieses Kindes in unserer Familie vor und leiten vielleicht auch schon die entsprechenden Schritte ein. Wir machen uns kundig, worauf wir achten müssen.
Natürlich kann ich dieses Wissen auch wieder verwenden, um damit eventuell eine Abtreibungsentscheidung herbeizuführen. Das wäre schlecht. Aber das macht ja nicht die Pränataldiagnostik in sich, sondern der Umgang von uns Menschen damit. Da sehe ich eher ein Problem auf Seiten der Rechtslage. Solange Gerichte Frauenärzte verurteilen, dass da ein Schaden für eine Familie entstanden worden ist und solange juristisch in diesem Sinn ein behinderter Mensch als Schaden steht, halte ich das für zutiefst diskriminierend gegen das Grundgesetz.
Das ist aber keine medizinische Frage oder eine Frage der Pränataldiagnostik, sondern wirklich eine Frage: Wie entscheiden Gerichte in solchen Fällen und verurteilen sie Frauenärzte, wenn solche Diagnoseverfahren nicht angewandt worden sind?
DOMRADIO.DE: Es kann ja trotzdem zu einer gängigen Praxis werden, wenn man als Eltern sagt, wir bekommen ein behindertes Kind – das möchte wir nicht.
Kleine: Das kann man so ohne weiteres nicht sagen. Meine persönlichen Erfahrungen als Seelsorger hier in Wuppertal sind sehr ambivalent. Die Menschen wissen, dass wir zwei Kinder mit Behinderung haben und weil ich in dem Sektor auch ehrenamtlich viel unterwegs bin, wird da manchmal auch um Rat gefragt. Übrigens auch vorgeburtlich, wenn bekannt geworden ist, da liegt möglicherweise eine Behinderung bei dem Kind vor.
Auch wenn da manchmal im Raum die Frage steht, soll eine Abtreibung durchgeführt werden, holen sich manche Eltern bei mir Rat – manchmal auch privat. Es gibt sehr viele Eltern, die sich für das Kind entscheiden, teilweise in sehr dramatischen Situationen, nicht nur bei einer Trisomie 21, die bei einem Down-Syndrom vorliegt, sondern ein Trisomie 18. Das sind Kinder, die oft nicht lange leben, wenn sie geboren werden. Ich hab da schon ganz viele Erlebnisse gehabt, wo Eltern sich bewusst für das Kind entschieden haben. Es ist Teil unseres Lebens und wenn es nur ein oder zwei Stunden in unserem Armen lebt, dann ist dieses Leben wertvoll und von Gott gegeben.
Diese Entscheidung gibt es auch. Trotz oder gerade wegen der Pränataldiagnostik, die da entsprechend durchgeführt worden ist. Es gibt eben auch die anderen Entscheidungen. Man kann es einfach nicht eindeutig sagen, es sind sehr individuelle Entscheidungen und kein Elternpaar, das ich erlebt habe – weder Mann noch Frau – haben sich diese Entscheidung, weder in die eine noch in die andere Richtung, leicht gemacht.
DOMRADIO.DE: Sie haben es gesagt, Ihre Tochter ist jetzt 20 Jahre alt. Haben Sie das Gefühl, dass sich die Einstellung in der Gesellschaft verändert hat?
Kleine: Wie gesagt, meine Frau und ich brauchen in diesen 24 Jahren, wo wir mit behinderten Kindern zusammenleben, keine fünf Finger dafür, um die Fälle aufzuzählen, wo wir wirklich dämliche Erfahrungen gemacht haben. Das sagt aber mehr über die Personen aus, die da entsprechend reagiert haben, als über unsere Kinder. Die Erfahrungen, die wir sonst mit unseren Kindern machen sind, ich will nicht sagen, durchweg positiv, aber angemessen.
Ich beobachte auch, dass gerade Menschen mit Down-Syndrom auf eine immer zunehmendere Akzeptanz stoßen. Das hängt natürlich auch davon ab, dass sie teilweise in den Medien sehr positiv wahrgenommen werden. Es gibt in Bonn dieses hervorragende "Ohrenkuss"-Projekt, behinderte Menschen geben eine Zeitschrift heraus. Hier in Wuppertal gibt es die "Glanzstoff"-Akademie, ein integratives Theaterprojekt, in dem behinderte Menschen in der Öffentlichkeit präsent sind. In der Schweiz gibt es etwa eine junge Frau mit Down-Syndrom, die schauspielert und mit Preisen überhäuft wird. Ich kann von daher nicht sagen, dass behinderte Menschen in dem Sinne jetzt auf große Inakzeptanz stoßen würden. Das kann man aus meinen Augen so nicht sagen.
Es gibt natürlich Menschen, die damit ihre Probleme haben. Aber im Großen und Ganzen nehme ich wahr, dass behinderte Menschen heute doch sehr viele Chancen in unserer Gesellschaft haben – und sie teilweise auch nutzen. Umso absurder ist dann eben manche Diskussion, in Richtung Pränataldiagnostik. Die These ist ja oft, dass die Pränataldiagnostik dazu genutzt werden soll, um massenhaft Menschen abzutreiben.
Ich bin natürlich nicht so naiv und weiß, dass das passiert. Rein statistisch gesehen müsste ein Kind von 700 Kindern ein Down-Syndrom haben. Der Bevölkerungsanteil ist niedriger, also weiß ich, dass dort viele Menschen schon im Fötusalter ihr Leben verlieren. Ich glaube, dass wir da tatsächlich auch auf anderen gesellschaftlichen Ebenen, auch als Kirche diskutieren und zu einem positiven Bild beitragen müssen, nämlich das Leben von Menschen mit Behinderungen ist lebenswert. Wenn Sie unsere beiden Kinder sehen, dann merken sie, Gottes Lebensart pulsiert dort mit einer solchen Macht und Freude, mit allem, was das Leben zu tun hat. In Trauer, Leid, Freude und Spaß. Das ist Leben, das absolut lebenswert ist.
Das Gespräch führte Renardo Schlegelmilch.