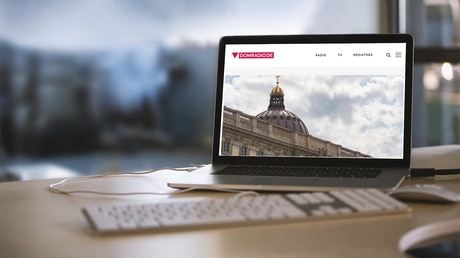"Als Katholik bin ich stolz auf sie, als Amerikaner habe ich von ihr gelernt“, bekannte der damalige US-Präsident John F. Kennedy nach der Lektüre des letzten Rundschreibens von Johannes XXIII. - die Enzyklika "Pacem in terris“ (Friede auf Erden) gilt heute als eine der wichtigsten kirchlichen Dokumente des 20. Jahrhunderts. Positiv reagierte auch Kennedys sowjetischer Gegenpart Nikita Chruschtschow. Johannes XXIII. hatte zuvor mit einer Audienz für dessen Schwiegersohn, den Chefredakteur der Moskauer Regierungszeitung "Iswestija“, Alexej Adschubej, großes Aufsehen erregt.
Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges
Mit der zwei Monate vor seinem Tod veröffentlichten Schrift "Pacem in Terris“ vollzog Papst Johannes XXIII. am 11. April 1963 eine radikale Wende. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges und der Furcht vor atomaren Erstschlägen erkannte er damit die Menschenrechte an.
Wenige Monate nach der Kubakrise, mit der die Gefahr eines Atomkriegs verbunden war, richtete der Papst eine Enzyklika erstmals nicht nur an Katholiken sondern "an alle Menschen guten Willens“. In dem Schreiben betonte er, dass der Mensch mit Vernunft und Willensfreiheit ausgestattet sei. "Er hat Rechte und Pflichten, die unmittelbar und gleichzeitig aus seiner Natur hervorgehen, Rechte und Pflichten, die allgemein gültig, unverletzlich und unveräußerlich sind.“
Die Enzyklika würdigte nicht nur das neue Bewusstsein für die Rechte von Arbeitern und die wachsende Anerkennung der Rolle der Frauen in der Gesellschaft. Die Achtung der Rechte und Pflichten bezeichnete Johannes XXIII. zugleich als Grundlage internationaler Politik. Kein Staat dürfe einen anderen unterdrücken. Wirtschaftlich stärkere Nationen müssten solidarisch mit Entwicklungsländern sein.
Für eine Weltregierung
Aus der Notwendigkeit, das Allgemeinwohl aller Menschen und Nationen zu schützen, folgerte Johannes XXIII., "dass eine universale politische Gewalt eingesetzt werden muss“. Diese Weltregierung sollte in den Augen des langjährigen Vatikandiplomaten, der 1958 zum Papst gewählt worden war, der zunehmenden Vernetzung Rechnung tragen, die heute unter dem Begriff Globalisierung bekannt ist. Doch mit der Forderung sollte nicht auf die Schaffung eines globalen Superstaates angespielt werden, heißt es heute. Es gehe mehr um Transparenz und Glaubwürdigkeit auf allen Ebenen des öffentlichen Lebens.
Zwei Jahre nach dem Bau der Berliner Mauer erteilte der bis heute vielfach als naiv und gutmütig geltende Johannes XXIII. Vorstellungen eines gerechten Krieges eine Absage. Unter dem Eindruck von Massenvernichtungswaffen habe sich die Überzeugung entwickelt, dass Konflikte zwischen Staaten und Völkern nicht durch Waffengewalt, sondern allein durch Verträge und Verhandlungen beizulegen seien. "Darum widerstrebt es in unserem Zeitalter, das sich rühmt, Atomzeitalter zu sein, der Vernunft, den Krieg noch als das geeignete Mittel zur Wiederherstellung verletzter Rechte zu betrachten.“
Für den Münchner Erzbischof, Kardinal Reinhard Marx, ist die Enzyklika mit ihrer Forderung nach weltweiter Abrüstung auch deshalb noch aktuell, weil sie betont, dass, wahrer Friede nicht nur Abwesenheit von Krieg bedeute, sondern "nur durch gegenseitiges Vertrauen fest und sicher bestehen kann“. Der europäische Einigungsprozess kann aus Sicht des Vorsitzenden der Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen der Deutschen Bischofskonferenz durch die Entwicklung internationaler Beziehungen auf der Grundlage von Wahrheit, Gerechtigkeit und Solidarität ein Beitrag auf dem Weg zum Weltfrieden sein.