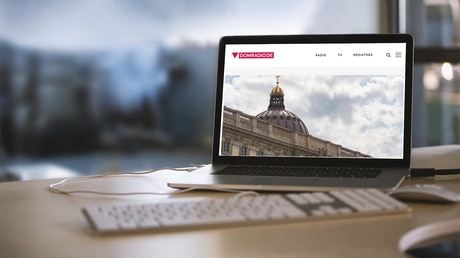DOMRADIO.DE: Frau Böhme-Barz, als Sie 2011 die Leitung der Abteilung Stiftungszentrum im Erzbistum Köln übernommen haben, gab es gerade einmal 15 Stiftungen plus Nachlässe und Schenkungen. Nun gehen Sie Ende des Monats in den Ruhestand und übergeben ein gut bestelltes Haus…
Elke Böhme-Barz (Leiterin des Stiftungszentrums): Auch heute ist die Szene der Stiftungen immer noch recht überschaubar, trotzdem hat die Idee des Stiftens deutlich an Fahrt aufgenommen. Das gilt nicht nur für unsere Diözese, sondern auch bundes- und sogar weltweit – denkt man nur an Bill Gates und die Schlagzeilen, die er sich mit seinem sozialen Engagement über seine Stiftung seit Jahren sichert.
Auch wenn das eher ein sehr prominentes Beispiel ist, so ist doch auch grundsätzlich in den letzten Jahren die früher eher anonyme Stifterwelt sehr viel transparenter geworden. Was gleichermaßen auch auf die vielen weitaus bescheideneren Stiftungen zutrifft. Verknüpfte sich jahrzehntelang mit einer Stiftung eher die Erinnerung an einen Verstorbenen, der die Gründung einer Stiftung als "letzten Willen" testamentarisch verfügt hatte, so heben heute die meisten Menschen – jedenfalls die, mit denen wir zu tun haben – bereits zu Lebzeiten eine Stiftung aus der Taufe, weil sie den Wunsch haben, damit eine Geschichte zu erzählen, die über ihren Tod hinaus wirken soll. Dabei motiviert sie natürlich primär, anderen etwas Gutes zu tun. Und von diesem Gedanken lassen sich immer mehr anstecken: Heute verwalten wir 29 Stiftungen plus 14 Stiftungsfonds. Das ist schon ein beachtlicher Zugewinn.
DOMRADIO.DE: Demnach hat sich das Verständnis von Stiften grundlegend gewandelt?
Böhme-Barz: Ich sage immer: Stiften ist Hoffnung in die Zukunft. Früher war es gang und gäbe, erst bei der Testamentseröffnung von dem Vorhaben einer Stiftung zu erfahren, was für die Erben manchmal überraschend kam. Auch glaubte man lange, nur mit großen Summen aktiv werden zu können. Dabei reicht auch schon ein schmaleres Bankkonto aus, um ein bestimmtes Projekt fördern zu wollen und sich hier mit viel Herzblut in einer Stiftung einzubringen. Man kann ja mit einem kleinen Betrag anfangen und die Stiftung mit Zustiftungen zum Wachsen bringen. Keineswegs geht es immer nur um die wirtschaftlich potente Gesellschaftsschicht, die sich so etwas leisten kann.
Auch was die Begünstigung durch Stiftungsgelder angeht, muss es nicht gleich eine Förderung im großen Stil sein. Oft geht es um viele, viele kleinteilige Hilfen, die an Stellen Freude schenken, wo man es gar nicht vermuten würde. Es ist also manches anders geworden in der letzten Dekade. Wir haben Standards entwickelt. Und wir kennen heute unsere Stifter persönlich, sind immer im Gespräch mit ihnen, halten Kontakt und vernetzen sie auch untereinander. Das heißt, sie bilden eine Art Community – eine Stiftergemeinschaft. Sich als Teil eines großen Ganzen zu erleben tut ihnen merklich gut. Mit anderen Worten: Der Nimbus des Elitären ist geschrumpft.
DOMRADIO.DE: Schon zu Lebzeiten eine Stiftung zu gründen hat also viele Vorteile?
Böhme-Barz: Jedenfalls beobachte ich bei den Stiftern immer eine große Freude, die sie sich vorher so nicht vorgestellt hätten. Denn sie erleben noch mit, was ihre Stiftung bewirkt. Es gibt ihnen ein gutes Gefühl, etwas zutiefst Sinnvolles zu tun. Unsere Aufgabe ist, den administrativen Support dazu zu liefern – von Anfang an. Diejenigen, die etwas stiften, sind beseelt davon, etwas an die Gesellschaft zurückzugeben, wenn sie es selbst gut im Leben hatten. Das ist ihre Form von Dankbarkeit oder – wenn Sie so wollen – ein Zeichen ihrer Zuversicht.
Sie schaffen etwas Nachhaltiges und verbinden damit eine sehr persönliche Herzensangelegenheit. Gemeinsam überlegen wir dann, wohin das Geld gehen soll, welche Not damit gelindert werden könnte, welcher Zweck festgelegt wird. Das sind immer sehr kreative Vorgänge. Dazu führen wir Gespräche, die in die Tiefe gehen und die Persönlichkeit des Stifters berühren. Eine Stiftung ist also alles andere als eine verstaubte oder gar tote Akte.
DOMRADIO.DE: Sie treffen viele unterschiedliche Menschen mit sehr unterschiedlichen Ideen. Gibt es etwas, was allen gemein ist? Was treibt Stifter an?
Böhme-Barz: Stiftern geht es darum, eine Verbindung in die Zukunft zu bauen. Stiftungen sind für die Ewigkeit – so merkwürdig sich das anhören mag – und eine nachhaltige Methode, sich mit nachkommenden Generationen ideell zu verbinden. Gerade Corona hat uns gelehrt, dass wir verletzlich geworden sind, unser Leben nicht unbedingt so weitergehen muss wie bisher, sich morgen am Tag das Blatt wenden kann. Und dieses Bewusstsein setzt in einer Mangelsituation sehr viel Kreativität frei, aber auch Sehnsucht: nämlich den anderen mehr in den Blick zu nehmen und sich für ihn einzusetzen, was zur menschlichen DNA gehört. In Zeiten, in denen wir doch sehr auf uns selbst zurückgeworfen waren und vielleicht auch noch sind, außerdem eine zunehmende Vereinzelung feststellbar ist, meine ich, ist das doch etwas sehr Tröstliches.
DOMRADIO.DE: Sie sagten es schon, das Stiftungszentrum verzeichnete in den letzten zehn Jahren einen Zuwachs an 14 Stiftungen und noch einmal so vielen Stiftungsfonds. Was ist das Geheimnis dieses Erfolgs?
Böhme-Barz: Dass es uns im Stiftungszentrum um Beziehungen geht und damit um letztlich zutiefst Menschliches. Wir leben doch davon, in Verbindung miteinander zu sein. Auch das hat die Pandemie gezeigt: Wo Beziehungen abbrechen oder nicht (mehr) gepflegt werden können, entsteht großes Leid. Aber als soziale Wesen wollen wir nicht uns selbst überlassen, einsam, hilflos, freud- oder wertlos für diese Gesellschaft sein. Wenn ich eines in diesen zehn Jahren gelernt habe, dann ist es, dass dieses Stiftungswesen bedeutet, in Beziehung und in Verbindung zu sein. Und: Stifter sind Gestalter.
Natürlich geht es nebenbei auch darum, die Werbetrommel zu rühren. Ich habe uns öffentlichkeitsfähig gemacht mit Flyern, Rollups, der Teilnahme am Kölner Stiftungstag oder Einladungen, bei denen Stifter einander die je eigene Geschichte erzählen. Damit werden Stifter zu Botschaftern für neue Stifter. Das ist echt toll! Wenn ich jemanden neu begeistern will, muss ich ihm außerdem zeigen, was aus seiner Idee werden kann und konkrete Wege zu diesem Ziel ebnen. Selbst nach seinem Tod leben eine Stiftung und die Idee dahinter weiter. Das gibt dem eigenen Leben noch über den Tod hinaus Sinn. Etwas Schöneres kann man sich doch gar nicht wünschen.
DOMRADIO.DE: Das vergangene Jahr hat uns gezeigt, wie zerbrechlich unser Leben ist, wie ohnmächtig wir agieren angesichts eines tödlichen Virus. Wie schauen Sie aus Ihrem Blickwinkel auf das letzte Jahr zurück?
Böhme-Barz: Corona hat uns neben vielen deprimierenden Erfahrungen die Chance eröffnet, über unser Leben und das, was wirklich zählt, neu nachzudenken. Und da ist es erstaunlich, wie viele Menschen bereit waren, anderen in Not zu helfen. Ja, es gab viele Anfragen nach Förderung – viel mehr als sonst, denn Corona hat viel verschämte Armut offengelegt. Aber es gab auch umgekehrt viele Angebote seitens unserer Stifter, unkonventionell einzuspringen und hier und da sehr unspektakulär zu helfen.
DOMRADIO.DE: Haben Sie nach Ihrem Ausscheiden aus dem Erzbistum für die Zukunft einen Wunsch?
Böhme-Barz: Ich würde mir wünschen, dass die Arbeit des Stiftungszentrums in ihrer Differenziertheit und Orientierung so nah an den Menschen in dem bisherigen guten Geist, an dem viele beteiligt sind, weitergeführt werden kann. Mit meinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen sowie den Stiftern und Spendern möchte ich in guter Verbindung bleiben.
Und natürlich ist mir wichtig, dass das Bewusstsein für das Thema Stiftungen grundsätzlich weiter wächst. Denn in Zukunft könnten Stiftungen eine noch viel größere Rolle dabei spielen, die ganze Vielfalt kirchlicher Aufgaben langfristig zu sichern. Es gibt kein nachhaltigeres Investment, als eine Stiftung zu gründen. Ich kann dazu nur ermutigen. Denn stiften heißt leben und das eigene Leben teilen.
Das Interview führte Beatrice Tomasetti.