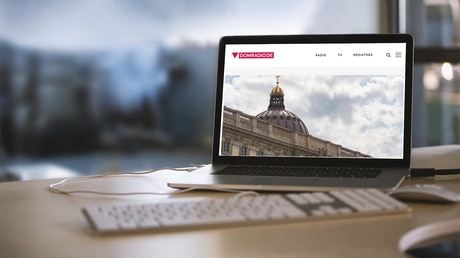Laut der UN-Organisation zur Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) haben bislang 337.000 Menschen den Norden Malis verlassen. Mehr als 15 Millionen Menschen sind nach Angaben von Oxfam insgesamt von der Krise betroffen.
Dabei gibt es in weiten Teilen der Region durchaus noch Lebensmittel zu kaufen: Auf dem Markt von Mopti in Zentral-Mali glänzen Tomaten, Gurken und Mangos in der Sonne. Marktfrauen nehmen frischen Fisch aus, der gerade an Land gebracht worden ist, und ein paar Stände weiter verhandelt ein Kunde eifrig über den Preis für eine Tüte knallroter Chili-Schoten. Nach einer Nahrungsmittelkrise sieht es im Zentrum der einst so beliebten Touristenstadt nicht aus. Zufrieden sind die Gemüsefrauen trotzdem nicht. "Früher hatte ich eine größere Auswahl. Außerdem muss ich meine Waren nun teurer einkaufen", berichtet eine.
Geringe Ernte, steigende Preise
Ganz anders als in Mopti sieht es in dem kleinen Dorf Wadouba aus, abgeschnitten von der Welt mitten im Dogon-Land. Knapp drei Stunden dauert die Fahrt mit dem Geländewagen von Mopti aus dorthin; das letzte Stück führt über eine Steinpiste. Hier lebt Moussa Ouologuem. Eigentlich ist er Landwirt; doch an Bewirtschaftung ist im Moment nicht zu denken. "Uns fehlt der Regen", sagt er und schaut zum Himmel. Die Sonne brennt. Moussa Ouologuem wirkt ruhig, obwohl er jeden Tag einen neuen Überlebenskampf kämpft. 21 Menschen muss er versorgen; wie, das weiß er häufig nicht.
Unterstützt wird er durch ein Projekt der Welthungerhilfe und ihrem lokalen Partner Molibemo. Sie verkaufen Hirse zu subventionierten Preisen. Für einen 50-Kilo-Sack benötigt man einen Berechtigungsschein vom Bürgermeister. Moussa Ouologuem hat ihn. Doch die Hirse für die Großfamilie reicht höchstens drei Tage. Er zuckt mit den Schultern.
Dass die Ernte in der Sahelzone 2011 äußerst schlecht ausgefallen ist, bestätigt auch Sabine Dorlöchter-Sulser vom Hilfswerk Misereor. Betroffen sei nicht nur Mali; auch in den Nachbarländern sei die Lage angespannt. Dort sank die Getreideproduktion gegenüber 2010 um 20 bis 56 Prozent; gleichzeitig stiegen die Preise massiv an. Der ohnehin schon arme Teil der Bevölkerung spürt das nun ganz besonders deutlich.
Politische Lage verschärft die Situation
Doch es ist nicht nur der fehlende Regen, der der Region zu schaffen macht. Immer stärker wird sie auch von der instabilen politischen Lage in Mali beeinflusst. Mitte Januar hatte im Norden des Landes die MNLA (Bewegung zur Befreiung von Azawad) eine Rebellion für mehr Autonomie oder sogar einen eigenen Staat begonnen. Am 6. April hat die MNLA, die häufig als Tuareg-Armee bezeichnet wird, schließlich den Staat Azawad ausgerufen - der jedoch international nicht anerkannt wird. Die Situation schien günstig, da in Bamako zwei Wochen zuvor eine Gruppe Soldaten geputscht hatte und sich die Aufmerksamkeit auf die Hauptstadt richtete.
Seitdem wird die Lage immer unübersichtlicher. Zudem zeigt sich, dass sich im Norden längst radikale Gruppierungen etablieren konnten, etwa Ansar Dine. Vor ihr, die in den eroberten Gebieten das islamische Recht, die Scharia, einführen will, haben weit mehr Menschen Angst als vor der MNLA. Und das sorgt nun für große Flüchtlingsströme in die Nachbarländer. Diesen müssen - selbst von der Dürre betroffen - nun noch weitere Menschen mit Nahrungsmitteln versorgen.
Auch in Bamako ist die weitere Entwicklung des Landes völlig unklar. Mit Druck der westafrikanischen Regionalorganisation Ecowas willigten die Putschisten zwar ein, die Macht abzugeben und einer Übergangsregierung zuzustimmen. Doch die hat ihr Ziel, bis 22. Mai Wahlen zu organisieren, verfehlt. Von Anfang an galt es als unrealistisch. Das Mandat der Übergangsregierung auf ein Jahr auszuweiten, wie es die Ecowas fordert, lehnen die Putschisten jedoch ab.
Die Krise Malis schwächt die ganze Sahelregion
Hunderttausende auf der Flucht
Im Sahel spitzt sich die Ernährungssituation weiter zu: Nach Schätzungen der Welthungerhilfe sind mittlerweile vier Millionen Menschen von akuter Nahrungsmittelknappheit bedroht. Ein weiteres Problem bereiten die Flüchtlingsströme, die seit Wochen nicht abreißen.

Share on