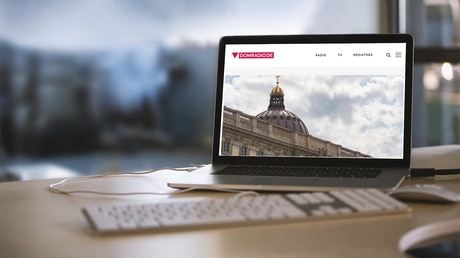domradio.de: Bringen Sie uns bitte zunächst einmal auf den aktuellen Stand. Wie ist die Lage in Somalia?--
Dorothee Klüppel: Die Lage in Somalia ist sehr schwer abzuschätzen. Betroffen ist ja die ganze Region, d.h. Dschibuti, Somalia, Äthiopien, auch Kenia stark ist stark betroffen, dazu Teile von Uganda - die Schwierigkeit in Somalia ist zusätzlich die, dass aufgrund des jahrzehntelangen Bürgerkriegs und des Fehlens staatlicher Strukturen dort internationale Akteure über die Jahre nicht tätig sein konnten und auch keine staatlichen Strukturen für die Unterstützung der eigenen Bevölkerung existieren.
domradio.de: Nun hat aber die Shebab-Miliz gesagt: OK, die Situation ist so schlimm, wir lassen jetzt doch internationale Hilfe zu. Inwiefern ist das zumindest bedenklich, wenn man diese Milizen unterstützt?--
Dorothee Klüppel: Das ist eine der Schwierigkeiten. Direkt unterstützen kann man sie natürlich auf keinen Fall. Es ist jedoch erst einmal ein gutes Zeichen, dass sie die internationale Hilfe jetzt wieder zulassen, dass man den Menschen wenigstens in der allergrößten Not zu Hilfe kommen kann. Das stellt sich natürlich schwierig dar, weil eben die entsprechenden Strukturen vor Ort fehlen, die müssen jetzt erst aufgebaut werden, Kontakte müssen geknüpft werden. Das ist keine einfache Situation und in der Tat war es in der Vergangenheit immer so, wenn in solchen Regionen mit solchen Akteuren vor Ort Unterstützung geleistet wurde, dass die dann bestimmte Teile der Unterstützung auch für sich abzweigen, was natürlich ein schwieriges Abwägen erfordert. Aber ich denke, die internationalen Organisationen, die vor Ort tätig sind, haben vor allen Dingen das Ziel, den extrem notleidenden Menschen zu helfen.
domradio.de: Es heißt, die Hungersnot werde sich in den kommenden ein bis zwei Monaten weiter ausbreiten, wenn jetzt nicht rasch massive Hilfe geleistet wird. Was muss jetzt passieren?
Dorothee Klüppel: Die Schwierigkeit ist, dass so eine Hungerkatastrophe natürlich nicht von heute auf morgen aufhört, weil ja auch die Dürre weiter besteht, die Regenzeiten sind zweimal in Folge ausgefallen, das heißt auch, dass keine Ernte eingebracht werden konnte, dass häufig das verbliebene Saatgut für die nächste Aussaat wegen des extremen Hungers gegessen worden ist, dass die Viehbestände vieler Hirtenvölker, die in dieser Gegend wohnen, das sind die Hauptbewohner dieser Regionen, gestorben sind oder extrem dezimiert wurden, das heißt, dass die Ressourcen, um eben wieder auf die Beine zu kommen, jetzt erst einmal alle weg sind. Das heißt, es muss jetzt auf der einen Seite kurzfristig Nothilfe geleistet werden, man muss - möglichst dezentral - Wasser, Nahrungsmittel, medizinische Versorgung zu den Menschen bringen. Dezentral deswegen, weil man ja am Beispiel des großen Flüchtlingslagers Dadaab in Kenia nahe der somalischen Grenze sieht, welche extremen logistischen Schwierigkeiten sich mit solchen großen Auffanglagern, solchen Flüchtlingscamps ergeben, d.h. es ist sehr viel besser, wenn man es schafft, den Menschen dort Unterstützung zu bieten, wo sie eben leben, damit sie in ihrer Region bleiben können. Im Zuge dieser kurzfristigen Nothilfe ist es allerdings auch wichtig, dass man gleich auch am Aufbau und der Rehabilitierung arbeitet. Rehabilitierung von Wasserrückhaltebecken, von Viehbeständen, es geht darum, wieder Saatgut zur Verfügung zu stellen, damit wieder gesät, angebaut und nach einer gewissen Zeit geerntet werden kann.
domradio.de: Bleiben wir einmal bei dem Ausblick auf das, was passiert, wenn jetzt die aktuelle Nothilfe angelaufen ist und den Menschen erst einmal geholfen werden konnte. Sie haben es selbst gesagt: In Somalia herrschen keine staatlichen Strukturen, die man unterstützen könnte, anders ist das in Kenia oder Uganda. Was hätte denn da dringend getan werden müssen, um eine solche Hungerkatastrophe zu vermeiden?--
Dorothee Klüppel: Staaten wie Uganda, Kenia, Äthiopien wären durchaus in der Lage, Frühwarnsysteme und Risikominderungsstrategien selbst zu erarbeiten. Eine solche Hungerkatastrophe ist ja nicht etwas, das von heute auf morgen über die Menschen hereinbricht, wie z.B. das schlimme Erdbeben in Haiti, sondern das zeichnet sich vorher ab, das baut sich allmählich auf. Es zeigt sich häufig, dass diese Katastrophen natürlich in Regionen auftreten, die klimatisch extrem benachteiligt sind, die aber auch durch den Staat selbst vernachlässigt werden. Da gibt es keine Infrastruktur, da gibt es keine existierenden oder funktionierenden Vermarktungssysteme und Märkte, die Politikorientierung der staatlichen Strukturen bezieht diese Räume nicht ausreichend mit ein, so dass durch diese Vernachlässigung der Regionen, in denen vielfach Nomaden und Kleinbauern leben, Dürren und Hungersnöten nicht frühzeitig entgegengewirkt werden kann.
domradio.de: Hätte es den Sinn, wenn da international mit dem Mittel der Entwicklungshilfe Druck auf diese Regierungen ausgeübt würde? --
Dorothee Klüppel: Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil der Entwicklungshilfe, den Dialog auch mit den politischen Stellen zu führen; wir von Misereor arbeiten z.B. mit lokalen Partnerstrukturen, größtenteils Diözesen zusammen und stärken die Partner darin und befähigen sie , mit ihren eigenen lokalen und nationalen Verwaltungen in den Dialog einzutreten, um eben die Verantwortung des Staates gleich mit einzubinden. Es kann nicht sein und es ist nicht das Ziel der Sache, dass die internationale Hilfe immer anspringt und von außen geholfen werden muss. In der aktuellen Situation ist das natürlich absolut notwendig, um die Menschen vor dem Verhungern und Verdursten zu bewahren, aber langfristig ist es nötig, dass die Staaten selbst die Verantwortung übernehmen und entsprechende Strukturen aufbauen, denn angesichts des Klimawandels ist nicht davon auszugehen, dass das die letzte Dürre am Horn von Afrika ist.
Dorothee Klüppel ist Abteilungsleiterin der MISEREOR-Abteilung Afrika und Naher Osten.
Interview: Stephanie Gebert
Misereor zur aktuellen Lage in Ost-Afrika
Betroffen ist die ganze Region
Zweimal in Folge ist die Regenzeit in der Grenzregion zwischen Somalia, Kenia und Äthiopien ausgeblieben. Millionen Menschen erleben derzeit die schlimmste Dürre seit der großen Hungersnot im Jahr 1950. Im domradio.de-Interview: Dorothee Klüppel, Abteilungsleiterin der Misereor-Abteilung Afrika und Naher Osten über die Schwierigkeiten der Hilfe und aktuelle Situation.

Share on