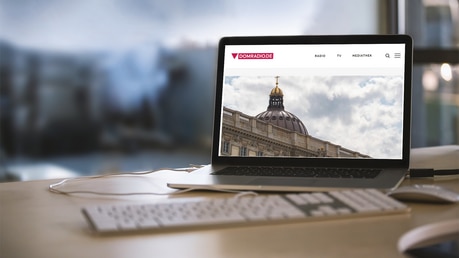In antiken Gesellschaften waren Bestattungen reine Familienangelegenheit, wie Reiner Sörries, evangelischer Pfarrer und Professor an der Universität Erlangen-Nürnberg in seinem gerade erschienenen Buch «Ruhe sanft - Kulturgeschichte des Friedhofs» schreibt. Man begrub seine Toten in prächtigen Grabgärten oder bescheiden am Straßenrand. Mit dem aufkommenden Christentum entstand dann ein neues Gesellschaftsbild: Die Gemeinde übernahm Funktionen der Familie und war von nun an auch für die Verstorbenen mit verantwortlich.
Friedhof - dieser Begriff hat, auch wenn es nahe zu liegen scheint, nichts mit dem Frieden zu tun, den die Verstorbenen nach ihrem Tod dort finden sollen. Der aus dem 9. Jahrhundert stammende Begriff des «Vrithofs», wie es im Althochdeutschen hieß, verweist auf den «eingefriedeten» Vorhof einer Kirche. Dieser Kirchhof, meist eine wenig gepflegte Wiese ohne Grabkennzeichnungen, diente seit dem Mittelalter als Begräbnisstätte für die Toten der jeweiligen Gemeinde. Der Kirchhof war jedoch kein Ort der Ruhe, denn hier weidete das Vieh, und die Gemeinde traf sich zu Märkten und bunten Veranstaltungen. Dies änderte sich im 16. Jahrhundert.
Zäsur durch Reformation
Die Reformation spaltete nicht nur die Christenheit, sondern auch das Friedhofswesen, das von nun nach Konfessionen getrennt war. Auch die Wahrnehmung als «Ruhestätte» hat hier ihre Wurzeln. Für den Reformator Martin Luther sollte der Friedhof ein Ort der Besinnung sein. Neben neuen hygienischen Vorstellungen ein Grund mit dafür, dass langfristig die Friedhöfe aus den damaligen Städten ausgelagert wurden.
Im 19. Jahrhundert übernahm der sich herausbildende Nationalstaat immer mehr Funktionen, für die zuvor die Kirchen zuständig waren. Auch der Friedhof wurde zu einer hoheitlichen Aufgabe; der konfessionelle wurde vielfach vom kommunalen Friedhof abgelöst. Erst jetzt entstanden die heute bekannten öffentlichen Friedhöfe, auf denen jeder, egal welchen Geschlechts und welcher Volks- oder Kirchenzugehörigkeit, Anspruch auf ein eigenes Grab besaß.
Ein weiterer Einschnitt zeigte sich seit den 80er Jahren des 20.
Jahrhunderts: Immer häufiger beerdigen seitdem Angehörige ihre Toten anonym auf der «grünen Wiese», da die Pflege der Gräber im Zuge der wachsenden Mobilität als Belastung empfunden wird. Laut Emnid-Umfragen sank die Zahl der Befragten, die sich ein traditionelles Erd- oder Urnengrab wünschen, von 87 Prozent 1998 auf nur noch 50 Prozent im Jahr 2007. Mit dem «Tag des Friedhofes», der erstmals 2001 ausgerufen wurde, versuchen Friedhofsverwaltungen, Kirchen sowie Friedhofsgärtner und Bestatter, die Bedeutung des Friedhofs als Ort der Trauer zu erhalten.
Trotzdem scheint sich im 21. Jahrhundert abzuzeichnen, dass «der kollektive, von der Kommune getragene Gemeinschaftsfriedhof nicht von Bestand sein wird», sagt Sorries, der auch Direktor des Kasseler Museums für Sepulkralkultur ist. Zugleich verliere der Friedhof seine Monopolstellung. Urnen im eigenen Garten, aus Asche produzierte Diamanten - die Bestattungsformen werden immer vielfältiger. Zugleich findet nach Meinung des Autors eine «Rekonfessionalisierung» statt, weil Menschen im Tod vermehrt Gleichgesinnte suchten. Neben muslimischen und buddhistischen Friedhöfen oder Gräberfeldern gibt es beispielsweise auch Friedhöfe für Fußballfans. Auch Friedwälder und Internet-Gedenkstätten lassen «das vertraute Grab auf einem herkömmlichen Friedhof» zu einer Alternative unter vielen werden, so der Autor.
Erst seit Martin Luther sind Friedhöfe auch Ruhestätten
Ruhe sanft
Sie sind eine Brücke zwischen der Welt der Lebenden und der Toten. Oft mitten in Städten oder Dörfern gelegen, sind Friedhöfe dennoch Gegenwelten, die eine einzigartige Atmosphäre entwickeln. Friedhöfe sind Ruhestätte der Toten und Orte der Erinnerung. Dabei ist der Umgang mit den Toten immer auch ein Spiegel der Gesellschaft.

Share on