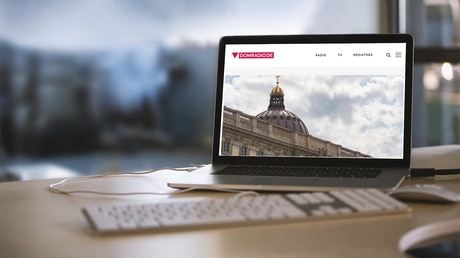Der erste Eindruck ist nicht schlecht: In der Siedlung mitten in Reisfeldern bauen eifrige Bauarbeiter neben den grünen Wellblechbaracken kleine Häuser aus Stein und Beton. Doch der Schein trügt - zumindest für diejenigen, die aus der Gemeinde Borei Keila in Phnom Penh zwangsweise hierher umgesiedelt wurden. Die Häuser seien für Menschen, die ihre Behausungen durch einen Erdrutsch verloren hätten, sagt Vendy. Die 43-Jährige gehört zu jenen 40 Familien, die Anfang Juli aus Borei Keila vertrieben wurden und nun am Rand des Dorfes Tuol Sambo 25 Kilometer von Phnom Penh entfernt leben.
Die Organisation "Ärzte ohne Grenzen" kritisiert etwa, die Behausungen würden nicht einmal den Minimalstandards für Flüchtlingslager entsprechen. In den Unterkünften sei es sehr heiß, berichtet Vendy. Auch sie ist HIV positiv, ihr Mann schon vor Jahren an Aids gestorben. Es gebe nur einen Brunnen. "Aber das Wasser können wir nur zum Waschen benutzen. Trinkbar ist es nicht." Zudem fehle es an Arbeitsmöglichkeiten. Und die Fahrt in die Stadt zum Geldverdienen kann sich kaum jemand leisten. "Wir habe hier oft nicht genug zu essen", klagt Vendy.
Profit machen andere
Auch fehle es an medizinischer Versorgung. Einmal im Monat fahren die HIV-Infizierten dank der Arbeit einer kleinen Hilfsorganisation in eine Klinik nach Phnom Penh, wo sie umsonst ärztliche Hilfe und Medikamente bekommen. Doch wer wegen akuter Probleme zum Arzt muss, muss das Geld für die Fahrt in die Stadt selber aufbringen. Immerhin sind die Hütten mietfrei; und es gibt Strom. Als Kompensation haben die umgesiedelten Familien von der Stadtverwaltung zusätzlich 25 Dollar und 50 Kilo Reis bekommen; vom Tourismusministerium, das auf dem Gebiet der ehemaligen Heimat der Familien ein neues Gebäude baut, 250 Dollar.
Auch in Borei Keila haben Vendy und die anderen in slumartigen Verhältnissen gelebt. Aber zumindest waren sie auf dem Papier Eigentümer des Landes, auf dem ihre Hütten standen. Nach Einschätzung der Hilfsorganisation "Housing Rights Task Force" hätten sie etwa 1.300 Dollar pro Quadratmeter bei einem Verkauf erzielen können. Aber der Rechtsweg scheint den Armen versperrt, ihre Anwälte werden eingeschüchtert und bedroht. Profit machen andere.
In Phnom Penh herrscht Goldgräberstimmung auf dem Immobilienmarkt. Investoren, die oft anonym bleiben, verschaffen sich mit Hilfe von Regierung, Polizei und Militär die besten Grundstücke in der Stadt.
Und die Vertriebenen aus Borei Keila sind nur die Spitze des Eisbergs. Alleine zwischen 2003 und 2008 sind nach Angaben der kambodschanischen Menschenrechtsorganisation LICADHO in Phnom Penh mehr als 30.000 Menschen aus ihren Siedlungen vertrieben worden. Die Organisation spricht von Landraub und dem "größten Menschenrechtsproblem in Kambodscha".
Die nächste Vertreibung steht wohl schon bevor
Die internationale Gemeinschaft und Geberländer, so ein Vorwurf der Betroffenen, hätten dazu bislang geschwiegen. Aber nach der Vertreibung der "Aidsfamilien" scheint die Geduld am Ende zu sein. In einem auch von der deutschen Botschaft in Phnom Penh unterzeichneten Schreiben fordern verschiedene Länder sowie die Weltbank, die Vereinten Nationen und die EU die Regierung Kambodschas auf, die Vertreibungen im Land "zu stoppen, bis ein fairer und transparenter Mechanismus zur Lösung der Landstreitigkeiten eingeführt und eine umfassende Umsiedlungspolitik entwickelt worden ist."
Doch die nächste Vertreibung steht wohl schon bevor. Eine Firma lässt den mitten in Phnom Penh gelegenen Boeung Kak See zuschütten, um auf dem so gewonnenen Land Luxuswohnungen, Hotels und Einkaufszentren zu bauen. Mehr als 4.000 Familien sowie kleine Hotels, Läden und Restaurants am Seeufer werden in den nächsten Monaten weichen müssen.
In Kambodscha werden Arme und HIV-Infizierte zwangsumgesiedelt
Eingeschüchtert und bedroht
Zwangsumsiedlungen sind in Kambodscha keine Seltenheit, doch dieser Fall ist speziell: In jeder der betroffenen Familien ist mindestens ein Mitglied mit HIV infiziert. Menschenrechtsorganisationen sprechen von "Aids-Kolonien" - und prangern auch die schlechten Bedingungen in Tuol Sambo an.

Share on